![]()
30. Mai 2005
![]()
Größte Heiterkeit im Stelenfeld
Tagsüber launiges Gewimmel, abends ein Ort für Küsse: Der Umgang mit dem Holocaust-Mahnmal läßt an der Gedenkstätte (ver)zweifeln
Kai Ritzmann
[...] Natürlich seien "die Gedanken frei", räumt Andreas Nachama mit Blick auf das neue Denkmal-Sightseeing ein. Niemand könne "vorschreiben, wie die Besucher zu reagieren haben". Ganz verfehlt sei nun eine Publikumsbeschimpfung. Schließlich verhielten sich die Menschen exakt so, wie sie durch das Mahnmal "angesprochen" würden. Damit stößt der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin ins Herz der Dinge vor. Er benennt Ursache und Wirkung. Die Ursache des Mißvergnügens ist das Mahnmal selbst. [...]
29. Mai 2005
![]()
Vom Kommen und vom Gehen
Es ändert sich etwas für sie in Deutschland, sagt der Präsident des Zentralrats der Juden. Zum Schlechten. Vielleicht stimmt das, aber es ist nicht alles
Michael Gleich
[...] Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland hatte sich vor kurzem im „Spiegel“ über das Verhältnis zwischen den Deutschen und den hier lebenden Juden geäußert. Er scheint resigniert zu haben. Ihm falle eine verstärkte Relativierung der Nazi-Verbrechen auf, die Tendenz, einen Schlussstrich zu ziehen, und er bezog sich dabei auf Stimmen, die aus der politischen und gesellschaftlichen Mitte Deutschlands kommen. Spiegel sagte: „Du kannst also machen, was du willst, du erreichst nichts.“
[...] Andreas Nachama, ein liberaler Rabbiner, bis 2001 Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, leitet heute die Stiftung Topographie des Terrors. „Keiner von uns ist Moses“, sagt er. „Mir scheint, Paul Spiegel hat einen falschen Zugang. Natürlich arbeitet man für das Ganze. Aber was im Geschichtsbuch übrig bleibt, ist nichts.“ Andreas Nachama sieht von seinem Stiftungsbüro aus auf das Berliner Abgeordnetenhaus und den Martin-Gropius-Bau. „Moses ist ein bescheidener Mensch“, sagt er. Und: „Nachdem Hitler Selbstmord begangen hatte, gab es sogar noch viele Totenmessen für ihn. Trotzdem ist eine Demokratie entstanden und trotzdem gibt es hier jetzt große jüdische Gemeinden. Als ich 1962 meine Bar-Mizwa-Feier hatte, sagte mein Rabbiner: ,Im Jahre 2000 wirst du einer von 800 Juden sein, die noch hier leben.’ Jetzt sind wir 11000.“ [...]
19. Mai 2005
![]()
21. Mai 2005
![]()
Ausstellung über das Gefängnis der Gestapo
Topographie zeigt Methoden des NS-Terrors
Die Gedenkstätten "Topographie des Terrors" plant eine Ausstellung über das "Hausgefängnis der Gestapo". Sie soll nach langjährigen Recherchen einen systematischen blick auf die Methoden des NS-Terrors werfen. [...] "An diesem Ort zeigt sich, wie das NS-Regime auf der einen Seite den Genozid detailliert plante und umsetzte und auf der anderen Seite jeden Widerstand gegen sich mit äußerster Brutalität zu vernichten suchte", sagte Andreas Nachama, Geschäftsführender direktor der Stiftung Topographie des Terrors, zu dem Ausstellungsprojekt.
Weitere Presseausrisse zur Topographie des Terrors
19. Mai 2005
![]()
Verfassungsschutz schwärzt Rabbiner an
Typisch antikommunistische Analyse oder »nur« Schlamperei?
René Heilig
Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) hat sich dagegen verwahrt, die Bundesministerien in eine historische Kontinuität mit den Behörden der NS-Zeit zu stellen. Er lege »großen Wert« darauf, dass die Tätigkeit seines Ministeriums 1949 beginnt. Wie der jüngste Verfassungsschutzbericht, den er am Dienstag vorgestellt hat, vermuten lässt, täte ein Hauch Antifaschismus gerade seinem und nachgeordneten Ämtern gut.
[...] Aufgelistet werden unter anderem »Organisationen im Umfeld der DKP«. Von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) wird behauptet, dass sie sich »auf die – typisch kommunistischer Analyse entsprechende – Propaganda beschränkt«. Beweis: Ein Artikel im »VVN-BdA-Organ ›Antifa‹, Oktober/November 2004, S.15«.
So konkrete Vorwürfe machen neugierig. Wer nachschlägt, stößt auf ein Interview mit dem Berliner Rabbiner Andreas Nachama, der als Geschäftsführender Direktor der Berliner Stiftung Topographie des Terrors Auskunft über althergebrachten und neuen Antisemitismus in Deutschland gibt. Der Beweis macht stutzig: Sollte der Verfassungsschutz wirklich die Frechheit besitzen, diesen für Demokratie und Menschlichkeit engagierten Mann zu einem Extremismus-Verdächtigen zu stempeln?!
Ein erneuter Abgleich mit dem Verfassungsschutzbericht verwirrt zusätzlich. Denn hier wird behauptet, die Quelle sei »einer der beiden gleichberechtigten VVN-BdA-Vorsitzenden, Prof. Heinrich Fink«. [...]
19. Mai 2005
![]()
Hausgefängnis der Gestapo
Berlin (ddp-bln). Die Stiftung Topographie des Terrors plant für den Sommer eine neue Ausstellung über das «Hausgefängnis der Gestapo». Die Schau widmet sich den Opfern der politischen Verfolgung, den Mechanismen des Terrors und der Verfolgungspraxis in der NS-Zeit, wie die Stiftung mitteilte. Die Open-Air-Ausstellung soll voraussichtlich im August auf dem Gelände der Topographie in der Niederkirchnerstraße in Kreuzberg geöffnet werden.
«Der Grundgedanke der neuen Ausstellung ist es, die Dimensionen des Gestapo-Terrors gegen politische Gegner des NS-Regimes und seine Rolle bei der Absicherung der verbrecherischen NS-Politik aufzuzeigen», sagte der Geschäftsführende Direktor der Stiftung Andreas Nachama.
19. Mai 2005

Der Streit
Christoph Amend
Mit Hitlers Buch "Hitlers Volksstaat" hat Götz Aly eine lebhafte Debatte ausgelöst. Er nimmt das Thema sehr persönlich, weil es um seine eigene Vergangenheit geht und um die seines Vaters.
[...] Berlin, Martin-Gropius-Bau, ein paar Tage später. Aly ist auf dem Weg zu einer Anhörung, in der darüber diskutiert werden soll, wie in Berlin der NS-Verbrechen gedacht werden soll. Im Fahrstuhl begegnet er Andreas Nachama, dem Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Es ist eng, man steht sich fast auf den Füßen. Die beiden haben sich kaum begrüßt, da legt Aly los. »Herr Nachama, erklären Sie mal, was den Steinbach qualifiziert für den Job in Ihrer Stiftung!« Peter Steinbach ist derzeit verantwortlich für die wissenschaftliche Leitung der Stiftung. Aly: »Was sind denn Steinbachs Leistungen?« Nachama: »Dazu sage ich nichts, Herr Aly. Wir sind hier im Fahrstuhl, nicht im Beichtstuhl.« [...]
19. Mai 2005
![]()
Der lange Schatten des 8. Mai
Eine Geschichtsstunde ganz ohne Missverständnisse oder böse Bemerkungen in Steglitz-Zehlendorf
wvb
In der Südwest-CDU interessieren sich viele für Geschichte. Allerdings gibt es Parteifreunde, die bei Diskussionen über das Kriegsende und den Umgang mit der Nazi-Zeit zu missverständlichen Äußerungen neigen.[...] Keine ganz ungefährlichen Voraussetzungen für einen Abend zum 8. Mai 1945, der überschrieben war mit dem Titel „Nach der Katastrophe“. In der Einladung hieß es, man wolle über „die Ambivalenz dieses historischen Datums“ sprechen. Um Schuld und Sühne sollte es also gehen, um Kriegsursachen und Folgen. Zwei Historiker saßen als Garanten nicht allzu irrlichternder Deutungen auf dem Podium – Manfred Wilke, der CDU verbunden, und Andreas Nachama von der Topographie des Terrors. Beide erinnerten, man muss das wohl immer wieder tun, an den staatspolitischen Anfang des nationalsozialistischen Terrors am 30. Januar 1933 – das war eben auch der Beginn der „Katastrophe“ von 1945. Heute verbänden die meisten mit dem Datum 8. Mai 1945 den Begriff „Befreiung“, sagte Nachama. Doch in Deutschland habe sich nur eine Gruppe selbst befreit vom Nazi-Wahn – die Trümmerfrauen, die die Städte wieder aufbauten. [...]
14. Mai 2005
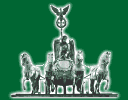 Berliner
Morgenpost
Berliner
Morgenpost
"Der Ort wird seine Würde entwickeln"
Holocaust-Mahnmal für das Publikum geöffnet - Lea Rosh verzichtet auf das Deponieren eines im KZ gefundenen Backenzahns
Kai Ritzmann
[...] Auch Andreas Nachama, geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, möchte den Menschen "nicht vorschreiben, das Denkmal mit gesenktem Kopf zu betreten". Vielleicht, fügt er hinzu, "verlassen sie es ja so". Der Ort, da ist er sich sicher, werde "seine eigene Würde entwickeln". [...]
12. Mai 2005

Leben nach dem Überleben
Ein Gespräch mit Zeitzeugen in der Synagoge Hüttenweg
Anke Ziemer
| [...] Rabbiner Andreas Nachama berichtete über den Neuanfang des Gemeindelebens, den einige Überlebende mit öffentlichen Gottesdiensten am 6. und 11. Mai 1945 selbst begonnen hatten. Wenige Monate später startete ein sechsköpfiger Gemeindevorstand mit der Registrierung der Mitglieder. |
|
Ende 1945 zählte die Gemeinde etwa 7.000 Mitglieder. Von ihnen waren zirka 1.500 aus den Konzentrationslagern zurückgekommen. Rund 1.300 hatten in Verstecken und etwa 4.200 als Ehepartner von Nichtjuden überlebt.
[...] Für mehrere zehntausend Displaced Persons richtete die UNRRA insgesamt fünf Lager ein, um sie zu versorgen und zu repatriieren. „Ich kann mich gut an die bescheidenen Zustände im Camp Düppel erinnern, weil meine Mutter dort einige Zeit gearbeitet hat“, ergänzte Ruth Nube die Ausführungen von Rabbiner Nachama. „Schon vor 1933 war sie als Heilgymnastin tätig, und ihre Patientenliste liest sich heute wie das Who’s who des damaligen deutsch-jüdischen Berlin.“
[...] „Auch wenn Rabbiner Abramowitz aus gesundheitlichen Gründen absagen mußte, wollten wir dennoch die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, den Tag der Befreiung aus einer jüdischen Perspektive zu betrachten“, erklärte Hartmut Bomhoff vom Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg die Intention des Treffens. „Während in den großen Veranstaltungen die Anerkennung für die sowjetische Armee überwiegt, möchten wir an die amerikanischen Militärrabbiner erinnern, die in Berlin und Deutschland die Weichen für ein neues jüdisches Leben gestellt haben.“
2. Mai 2005
![]() 1
1
"Was Lea Rosh tut, ist geschmacklos"
Gunnar Schupelius
Hat sie sich jetzt verrannt? Es war bei der Einweihung des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Prominenz, Weltpresse. TV-Journalistin Lea Rosh spricht, die Initiatorin des Denkmals. Plötzlich zieht sie einen Backenzahn aus der Tasche. Er gehörte einem von den Nazis ermordeten Juden. Sie fand ihn im Vernichtungslager Belzec [...]
"Ich finde das Vorgehen von Lea Rosh pietätlos", sagt Paul Spiegel, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. "Ich war peinlich berührt und geschockt", sagt der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, Andreas Nachama. Julius Schoeps, Leiter des Moses Mendelssohn Zentrums: "Das war ausgesprochen geschmacklos." Auch Albert Meyer, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, ist entsetzt: "Das verstößt gegen jüdische Beerdigungsriten. Sollte Frau Rosh ihren Plan wahr machen, müssen wir Juden überlegen, ob wir diesen Ort überhaupt betreten können." [...]
11.Mai 2005
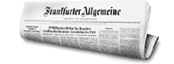
Mahnmal-Eröffnung
Steine auf dem Weg des Gedenkens
Mechthild Küpper
[...] Etwa zur selben Zeit wie der Gedanke, in der neuen Bundeshauptstadt an die jüdischen Opfer der Naziherrschaft zu erinnern, war auch der Plan entstanden, auf dem Grundstück der Gestapo, der SS und des Reichssicherheitshauptamtes die „Topographie des Terrors” zu zeigen.
Eine fast sensationelle Neuigkeit
Inzwischen sind die Treppenhäuser des Architekten Zumthor abgerissen, dessen Entwurf nicht gebaut werden konnte, und als am Montag Andreas Nachama, der Geschäftsführende Direktor der Topographie-Stiftung, sagte, der Wettbewerb für ein neues, schneller und leichter zu bauendes Haus könne womöglich bis zum Ende dieses Jahres fertiggestellt werden, war das eine fast sensationelle Neuigkeit.
5. Mai 2005
![]()
Nach Jahren der Debatte ist das Denkmal für die ermordeten Juden Europas vollendet. Eine Besichtigung
[...]
Er [Eisenman] will rühren, und er will läutern, er will ergreifen durch Größe und überzeugen durch Aufklärung. Das ist viel, und viele meinen: zu viel. Kann, soll und wird das Denkmal all dies leisten? Gegner des Bauwerks sehen es als den Versuch, durch schiere Masse einen Schlussstrich zu ziehen unter die Schuld der Deutschen. Das zudem von einem jüdischen Architekten entworfene Holocaust-Mahnmal sei ein Denkmal von Deutschen für Deutsche, meinten vor allem jüdische Kritiker; die Angehörigen der Verfolgten jedenfalls seien nicht in Gefahr, die Gräueltaten zu vergessen.
Als seinerzeit der Streit um die Verwendung spezieller Anstriche der Firma Degussa tobte, bemerkte Andreas Nachama, früherer Leiter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und Mitglied im Kuratorium des Mahnmals: „Was interessiert die Juden in Deutschland, wenn Nichtjuden ein Denkmal bauen. Sollen sie sich das Ding doch hinsetzen.“ Genau das haben sie getan.
6. Mai 2005
 Jüdische Allgemeine
Jüdische Allgemeine
Haus der Steine
Das Lapidarium auf dem Jüdischen Friedhof wird eröffnet
Christine Schmitt
„Daß viele Grabsteine einfach umgekippt an den Wegrändern des jüdischen Friedhofes an der Schönhauser Allee herumlagen, hatte mich schon lange gestört“, sagt Andreas Nachama. Lieblos habe das ausgesehen. Doch das gehört nun der Vergangenheit an. Denn jetzt steht das Lapidarium („Steinhaus“) kurz vor seiner Fertigstellung. Darin werden siebenundfünfzig dieser Grabsteine einen neuen Platz finden. Elf Schautafeln sollen über den jüdischen Ritus der Bestattung informieren.
Der jüdische Friedhof, auf dem der Maler Max Liebermann, der Verleger Leopold Ullstein und der Komponist Giacomo Meyerbeer beerdigt worden sind, sei Ende der neunziger Jahre in keinem guten Zustand gewesen, sagt Nachama, der damals Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin war. Auf dem 1827 eingeweihten Friedhof wurden bis 1880 etwa 22.500 Einzelgräber und 750 Erbbegräbnisse angelegt.
Durch die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg seien Grabsteine zerstört und von ihren angestammten Plätzen gerissen worden, erklärt der Rabbiner. Auch habe es in der Nachkriegszeit mehrere Schändungen gegeben. „Leider gibt es keinen Belegungsplan, mit dessen Hilfe man hätte nachvollziehen können, wo das entsprechende Grab ist.“ Der größte Teil des Friedhofverzeichnisses ist vernichtet, und die wenigen noch existierenden Verzeichnisse sind in so einem schlechten Zustand, daß sie nicht mehr eingesehen werden können. Doch die Grabsteine sollten würdig aufgestellt werden, beschloß damals der Gemeindevorsitzende. „Erst gab es die Überlegung, am Eingang einen bepflasterten Platz zu gestalten. Aber dann fand man Fundamente des alten Friedhofsgebäudes“, sagt Nachama. Es entstand die Idee ein Lapidarium zu bauen. Die Architekten Ruth Golan und Kay Zareh wurden im Jahre 2000 von der Gemeinde beauftragt, das Steinhaus zu planen und Geld bei der Lottostiftung dafür zu beantragen. Die Stiftung finanzierte schließlich das eine Million Euro teure Projekt. [...]
6. Mai 2005
![]()
Berliner empört über Tennis- Club Rot-Weiß
+++ Judenfeindliche Passagen im Programmheft zu den German Open +++ Empörte Zuschauer verließen "Ladies Day" +++ Club entschuldigt sich
VON F. GERDES und E. KÖHLER
[..] Dr. Andreas Nachama, 53, Direktor der Ausstellung "Topographie des Terrors" zur BZ: "Was die Autoren sich geleistet haben, ist unsensibel, gedankenlos, verwerflich. Ein gutes Beispiel, daß Geschichte nicht begriffen wurde. Es ist peinlich für unsere Stadt." [...]
Abraham Geiger Kolleg Frühjahr 2005
![]()
"Hat außer Singen nichts im Sinn"
CD-Präsentation mit Aufnahmen von Oberkantor Estrongo Nachama im Jüdischen Kulturverein
[...]
Soeben ist ein Live-Mitschnitt einer Schabbat-Feier mit Gesängen Nachamas herausgekommen, auf der er vom Chor der Synagoge Herbartstraße und von Monika Almekias-Siegl an der Orgel begleitet wird: ein schöner Anlass für seinen Sohn Rabbiner Dr. Andreas Nachama und für Rabbiner Dr. Walter Homolka, bei einer Veranstaltung im jüdischen Kulturverein am 10. April den Lebensweg von "Eto" nachzuzeichnen und mit Musikbeispielen zu illustrieren.
Die CD-Präsentation wurde in Teilen fürs Fernsehen aufgezeichnet und wird am 14. Mai Um 21 Uhr auf 3sat gezeigt. Informationen zum Vertrieb der CD "Schabbat-Feier Oberkantor Estrongo Nachama live" über wwvv,nachama.de
Mai 2005
![]()
Zwei Rabbiner über Estrongo Nachama
Rosa Lewin
Es wurde eine Veranstaltung mit vielen Höhepunkten. Das begann damit, dass ihre Leitung in den Händen zweier Rabbiner lag, die zu den prägenden Persönlichkeiten des liberalen Judentums in Berlin gerechnet werden: Neben Rabbiner Dr. Andreas Nachama saß Rabbiner Dr. Walter Hornolka, Gouverneur der Weltunion für progressives Judentum für Europa, der zu Beginn von der Dankesschuld des Abraham Geiger Kollegs und der liberalen Juden in Deutschland überhaupt gegenüber Estrongo Nachama sprach. Seinem Wirken als Kantor sei die Erhaltung der liberalen Musiktradition in Nachkriegsdeutschland zu verdanken, für die Namen wie Lewandowski, Sulzer und Naumburg stünden. Nachama sei für ihn von jung an das Vorbild eines Kantors gewesen, »der Kantor per se«. Homolka würdigte auch die Ver-dienste Andreas Nachamas namentlich um das Reformjudentum und nannte Etappen aus dessen Leben bis zur Synagoge am Hüttenweg (nun mit Sohn Alexander als Kantor). mehr
1. Mai 2005
![]()
| Trecks und Trümmerberge Am 4. Mai wird in der Zitadelle Spandau die große Ausstellung "Berlin 1945" eröffnet. Andreas Nachama hat für die "Welt am Sonntag" drei eindrucksvolle Foto-Dokumente ausgewählt: Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, fielen sich die Menschen um den Hals: Kein Krieg, kein äußerer Druck, keine Stadtguerilla, sondern friedliche Montagsdemonstrationen hatten im Gefolge der Veränderungen in anderen osteuropäischen Staaten ein autoritäres Repressionssystem, das auch vor dem Leben seiner Staatsbürger keinen Respekt hatte, wegrevolutioniert. Besonders in der DDR war man sich darüber im klaren, daß dies ein historischer Tag sei: eben "die Wende". mehr |
 |
