|

Tagebuch
31.12.15

Ökumenische Vesperandacht zum Jahresabschluss

40:55 Min. | Verfügbar bis 31.12.2016
Liturgie und Predigt: Pfarrer Christhard-Georg Neubert, Karmeliterin Schwester Mirjam, Rabbiner Andreas Nachama, Anne-Catherine Jüdes und Vikar Hannes Langbein Saxophonisten: Detlef Bensmann und Chen ChengOrgel: Lothar Knappe Das Erste überträgt den ökumenischen Silvestergottesdienst, der unter dem Motto Perspektivwechsel" steht, live aus der St. Matthäuskirche in Berlin-Tiergarten.Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will." Mit diesen Worten des Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, der in der St. Matthäuskirche ordiniert wurde, will der Gottesdienst Mut machen zu Rückblick und zuversichtlichem Aufbruch in ein neues Jahr - mit Gottes Segen.
31.12.2015

[…]Sprachgeschichte(n)
Rutsch, Rosch und Rausch
Hat der deutsche Neujahrsglückwunsch wirklich hebräische Wurzeln?
Christoph Gutknecht
Warum dann ein Rutsch-Wunsch zum Jahreswechsel?
Siegmund A. Wolf meint im Wörterbuch des Rotwelschen (1956),
»das sonst sinnlose guten Rutsch!« sei ein entstelltes Rosch Haschana.
Auch Andreas Nachama schreibt in seinem Jiddisch im Berliner Jargon (1994),
es sei »der gute Rutsch wohl eher als der gute Rosch des Jahres, der Neujahrsanfang, zu verstehen«
|
 |
25.12.2015

Thessaloniki
Aufstieg und Niedergang einer jüdischen Metropole
Igal Avidan
Wie kaum eine andere europäische Metropole war Thessaloniki seit alters her jüdisch geprägt. Doch die nationalistischen Griechen und später die Deutschen löschten die Zeichen der jüdischen Präsenz aus. Erst seit kurzem entdeckt die Stadt ihr Erbe neu. […]
Auf Initiative von Adolf Eichmann wurden 1943 die rund 50.000 Juden von Saloniki nach Auschwitz und Bergen-Belsen deportiert. Einer von ihnen war der spätere legendäre Berliner Kantor Estrongo Nachama, Jahrgang 1918, wie sein Sohn Andreas Nachama erzählt:
"Seine Situation war die, er war Soldat in der griechischen Armee, er hat gegen die Italiener gekämpft und sie waren eigentlich erfolgreich. Dann wurde er nach Hause geschickt. Und dann im März 1943, kurz vor Pessach, deportiert worden, nach Auschwitz."
Estrongo Nachama war einer der wenigen Überlebenden aus Thessaloniki. Nach dem Todesmarsch aus dem KZ Sachsenhausen blieb er in West-Berlin. Als er Griechenland 1959 besuchte, wurde er wegen Fahnenflucht verhaftet: Er habe sich nämlich 1947 dem griechischen Bürgerkrieg entzogen, hieß es. Als der betagte Estrongo Nachama 1994 seine Heimatstadt noch einmal besuchen und daher seinen griechischen Pass verlängern wollte, lehnte das die Außenstelle der griechischen Botschaft in Berlin ab:
"Und dann haben die ihm gesagt, nein, du kriegst keinen griechischen Pass mehr, denn du bist ein Deserteur! Dann habe ich – damals war Diepgen regierender Bürgermeister – mit Diepgen telefoniert. Er sagte, er hatte schon das Bundesverdienstkreuz und das ist kein Problem, wir werden ihm einen deutschen Pass geben. Da müssen wir einen Antrag auf Einbürgerung stellen, das kriegt er sofort, er lebt doch hier seit Jahrzehnten und so."
Und so wurde er Deutscher?
"So wurde er NICHT Deutscher. Denn er hat gesagt: 'Ich, deutscher Staatsbürger? Ich bin kein deutscher Staatsbürger, ich bin Grieche! Ich will keinen deutschen Pass!'"
Erst dank der Intervention des griechisch-orthodoxen Metropoliten Augustinus, der einst Estrongo Nachamas Zechbruder in der West-Berliner "Taverna" gewesen war, erhielt der Shoah-Überlebende, der mit griechischer Hilfe beinahe vernichtet wurde, endlich seinen griechischen Pass zurück – und damit ein Stück Heimat.[…].
22.Dezember 2015

»Stärke« besiegt »Wahrheit«
Gideon Joffes Bündnis erobert 13 Sitze, die Opposition acht
[…] Die Reaktionen auf Koachs Wahlsieg sind geteilt. Aus Sicht des früheren Gemeindevorsitzenden Andreas Nachama drückt das Wahlergebnis das aus, was »die Wähler empfunden« haben. »Das ist ein großer Erfolg für Emet, dass sie die Zweidrittelmehrheit verhindert haben. Damit haben sie schon viel erreicht.«
Mit gerade einmal zwei Stimmen über der Mehrheit müsse der Gemeindevorsitzende nach diesem Wahlergebnis mit der Opposition »anders umgehen«. Joffe habe jedoch »mit einer großen Kraft sein Programm durchgezogen«, betonte Nachama, »und einige Probleme gelöst, wie beispielsweise die Finanzen. Ich denke da an den Staatsvertrag, den er neu ausgehandelt hat. Den vor vier Jahren von der vorherigen RV um Lala Süsskind angekündigten Bankrott hat er abgewendet.« […].
17.12.2015

BVG
»Teil des Repressionsapparates«
Christian Dirks über die Berliner Verkehrsbetriebe und ihre Nazi-Vergangenheit
[…] Rabbiner Andreas Nachama schreibt im Vorwort zum Buch, dass seine Mutter nach der Schoa noch lange Problem hatte, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.
Es gab während der Nazi-Zeit unzählige Verordnungen, die Juden diskriminierten – da bildete die BVG keine Ausnahme. Sie war wichtig, um die Berliner von A nach B zu bringen, und immer mehr Menschen mussten Zwangsarbeit in den Rüstungsbetrieben leisten. Die BVG war zugleich Dienstleister und Peiniger. Juden durften zunächst zwar weiterhin die Verkehrsmittel benutzen, mussten ihren Platz im Zweifel aber für »Arier« räumen. Später wurde ihnen dann das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln gänzlich verboten. Die BVG war ein Teil des Repressionsapparates. […]
16.12.2015

Die Thesen des Berliner Theologen Notger Slenczka Nicht ohne das Alte Testament?
Thomas Klatt
Im vergangenen Frühjahr lösten umstrittene Thesen des Berliner Theologen Notger Slenczka eine erbittert geführte Debatte aus. Kein Wunder: Slenczka hatte nicht weniger als die Streichung des Alten Testaments aus dem christlichen Kanon gefordert.Sein Argument: Man müsse anerkennen, dass mit der Hebräischen Bibel das Volk Israel angesprochen werde – und nicht die Christenheit. Mehrfach wurde der Wissenschaftler scharf angegriffen. Und die Debatte geht weiter: Wie viel Altes Testament braucht die christliche Kirche?
[…]Auch der Berliner Rabbiner Andreas Nachama sieht die innerprotestantische Debatte mit Skepsis und Sorge. Schließlich könne vom deutschen Kulturprotestantismus eine direkte Linie zu den Deutschen Christen gezogen werden, die alles Jüdische aus der christlichen Bibel und Religion verbannen wollten.
"Dass die Christen in Deutschland jetzt zur Position der DC, der deutschen Christen im Dritten Reich zurückkehren, dass die Hebräische Bibel, das Alte Testament wieder verbannen wollen, das wird über kurz oder lang wieder dazu führen, dass es einen arischen Jesus geben soll, wir gucken uns das interessiert an."
Auch nach Jahrzehnten scheint der jüdisch-christliche Dialog immer noch ein zartes Pflänzchen zu sein, befürchtet Nachama. Sonst könnte solch längst als überwunden geglaubte christliche Theologie gegen die jüdische Religion nicht wieder – wie jetzt bei Slenczka – artikuliert werden. Das sieht so ähnlich auch Alexander Deeg, Professor für Praktische Theologie an der Universität Leipzig. Es brauche in der Kirche mehr Wertschätzung für die Hebräische Bibel. […]
11.12.2015

Jüdische Identität Darf man eigentlich Jude sagen?
Jens Rosbach
[…] Die Formulierung "deutsche Juden"
Berlin-Mitte, in der Gedenkstätte Topographie des Terrors. Vor einem meterlangen Bücherregal findet der Direktor, und Rabbiner, Andreas Nachama eine Antwort auf die Frage, wer die Formulierung "deutsche Juden" scheut und wer nicht.
"Meine Mutter ist ja Berliner Jüdin, die in den 20er-Jahren in Berlin geboren ist, hier aufgewachsen ist, hier versteckt war, den Holocaust überlebt hat und mich hier groß gezogen hat. Also ich gehöre ja sozusagen – wenn Sie so wollen – zu dieser Gruppe tatsächlich der deutschen Juden. Andere, deren Familien erst nach dem Holocaust als displaced persons vielleicht aus Ungarn, aus Polen, aus Rumänien, hierhergekommen sind, die würden sich sicherlich nicht als deutsche Juden bezeichnen. Da saßen die Eltern sozusagen auf gepackten Koffern und wollten wieder weg aus Deutschland, sind sie dann vielleicht nicht. Bei den deutschen Juden war das schon anders, die sind hier geblieben, weil sie Hitlers Testament nicht erfüllen wollten." […]
Die jahrhundertealte Verunglimpfung der Juden, zudem die sprachliche Markierung als Untermenschen im Nationalsozialismus, der abfällige Sprachgebrauch auf Schulhöfen – und schließlich: die innerjüdischen Debatten und Verunsicherungen. Fachleute, wie Historiker Andreas Nachama, resümieren: Das Wort "Jude" bleibt in der deutschen Sprache aufgeladen, belastet.
11. September 2015

Mitte Pfarrer, Rabbiner und Imam feiern Friedensandacht
Mitte. Die Geistlichen des House of One Berlin, Pfarrer Gregor Hohberg, Rabbiner Andreas Nachama und Imam Kadir Sanci laden am heutigen Freitag, 15 Uhr, zur multireligiösen Friedensandacht auf dem Petriplatz ein. Dort, wo künftig das House of One gebaut werden wird, feiern die drei Geistlichen im Gedenken an den 11. September 2001 und mit Blick auf die Flüchtlingssituation eine multireligiöse Friedensandacht. Das House of One ist ein Haus der drei Religionen.

11.September 2015
 Berlin Staatsempfang in Spandau
Zeitgeschichtliche Ausstellung mit Denkmälern aus dem öffentlichen Raum
Ein Stück vom Ohr fehlt. Vom Bärtchen ist etwas abgebrochen. Ansonsten ist der Granitkopf von Lenin unbeschädigt. Das 3,5 Tonnen schwere Objekt ist am Donnerstag auf der Zitadelle Spandau angekommen. Dutzende Kamerateams, Fotografen und Journalisten haben das Schauspiel verfolgt, wie bei einem Staatsempfang. [...]
Die Ausstellung sei gründlich vorbereitet worden und werde "zu einer Attraktion weit über Spandau und über Berlin hinaus", sagt Andreas Nachama, Mitglied im Beirat zur Ausstellung und geschäftsführender Direktor der Stiftung Topografie des Terrors.
17.08.2015

Stolpersteine
Steine des Anstoßes
Jens Rosbach
[…] Ein Mann mit Glatze, grauem Haarkranz und grauem Schnauzbart. Er steht auf einem roten runden Roll-Hocker, vor einer sechs Meter langen Bücherwand. Andreas Nachama, Rabbiner und Direktor der Berliner Gedenkstätte Topografie des Terrors. Der 63-jährige Historiker bewundert die unzähligen Stolperstein-Initiativen, die in den vergangenen 20 Jahren gegründet wurden; der Experte spricht von einer neuartigen, dezentralen Gedenkkultur. Zugleich würdigt er die Argumente der Gegner.
"Ich zum Beispiel finde das eine interessante Aktivität, meine Mutter hingegen hat mir verboten, für meinen Großvater, der hier in Berlin seinen letzten Wohnort hatte, bevor er verfolgungsbedingt gestorben ist, einen Stolperstein zu setzen, weil sie das unangemessen findet. Die Erinnerung an die Familie, das ist sozusagen etwas, das legt man nicht in die Hand anderer, wenn noch jemand aus der Familie da ist."
Andreas Nachama weiß natürlich, dass die bayerische Landeshauptstadt kürzlich Stolpersteine grundsätzlich verboten hat. Der Widerstand war von Charlotte Knobloch ausgegangen, der Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde München. Die Holocaust-Überlebende sieht die Pietät gefährdet, wenn Straßenschuhe die Erinnerungstafeln beschmutzen. Eine Debatte, die an den Umgang mit jüdischen Gräbern anknüpfe, erläutert der Berliner Rabbiner.
"Die ursprüngliche Idee eines Grabes war eben die, dass es sozusagen das Hügelgrab gab, das aus verschiedenen Feldsteinen bestand. Und das, wenn man es besucht hat, immer wieder aufgeschichtet wurde. Daher kommt auch dieser Brauch, auf den Grabsteinen einen Stein drauf zu legen. Und das bedeutet im Klartext, dass das Grabfeld eben nicht betreten werden konnte oder sollte."
Der Professor zieht aber einen anderen Schluss als Charlotte Knobloch, die auch Chefin des Zentralrats der Juden in Deutschland war.
"Ich sehe den Stolperstein nicht als ein Grab, da ist ja niemand beerdigt, ich sehe das nicht so."
Kein Grab. Sondern lebendige Erinnerung.
5. August 2015

Nachruf von Rabbiner Andreas Nachama
Zeitzeuge und Gestalter
Der frühere Gemeindevorsitzende Jerzy Kanal verstarb 94-jährig
Die jüdische Gemeinde trauert um Jerzy Kanal, der als Vizepräsident des Zentralrats und Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (1992–1997) sowie als langjähriges Direktoriumsmitglied und Aktivist für Keren Hayesod einer der bedeutenden Generatoren jüdischen Lebens im Nachkriegsdeutschland war. Jerzy Kanal ist am 1. August kurz nach seinem 94. Geburtstag im Kreise seiner Familie in seine Welt gegangen.
Noch bei der Beerdigung von Ruth Galinski am 21. September 2014 ließ es sich Jerzy Kanal nicht nehmen, im Rollstuhl sitzend nicht nur an der Trauerfeier teilzunehmen, sondern auch an die Gruft heranzufahren, um persönlich dazu beizutragen, das Grab mit Erde zu schließen.
Fast drei Jahrzehnte, von 1969 bis 1997, war Jerzy Kanal aktiv im Vorstand der Jüdischen Gemeinde tätig. Vorstandsvorsitzender wurde er als Stellvertreter Heinz Galinskis unmittelbar nach dessen Tod.
1993 stellte er sich der turnusmäßig anstehenden Wahl, die er gewann. »Von Generation zu Generation« war ein oft von ihm zitiertes Wort, denn er betrachtete sich als Mann des Übergangs, der das von Galinski begonnene Werk weiterführte und mit Leben füllte.
Wirken
So ist es denn kein Wunder, dass das erste große Werk unter seinem Vorsitz im November 1992 die Grundsteinlegung des Neubaus der 1995 eingeweihten Heinz-Galinski-Schule war. 1993 konnte er dann der Gemeinde die erste Jüdische Oberschule Deutschlands im alten Schulgebäude der Jüdischen Gemeinde übergeben. Im gleichen Jahr unterzeichnete er den von ihm ausgehandelten Staatsvertrag mit dem Berliner Senat, der die Beziehungen des Landes zur Gemeinde erstmals verbindlich regelte.
Höhepunkt seines Wirkens jedoch war die Einweihung der Neuen Synagoge als Centrum Judaicum am 8. Mai 1995. Hier verband sich für Jerzy Kanal seine Vorstellung von historischem Ort, der Vermittlung von Jüdischkeit in der Gegenwart mit der Option für eine hiervon ge- prägte Zukunft.
Wurzeln
Jerzy Kanal wurde 1921 im polnischen Schtetl Blaszki geboren und wuchs in Warschau in einer vom Judentum osteuropäischer Tradition geprägten Atmosphäre auf.
Er gehörte zu jenen wenigen, die im Elternhaus gelebte und im Cheder vertiefte jüdische Bildung ganz selbstverständlich verkörperten und zugleich doch mit beiden Beinen in dem von einer nichtjüdischen Umwelt geprägten Leben standen.
Die Verfolgung durch die Deutschen überlebte Jerzy Kanal im Warschauer Ghetto, in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern. Nach der Befreiung kam er über München, Warschau, Prag und Paris 1953 nach Berlin. 1948 heiratete er in Prag seine Frau Serena, die 1975 nach 27-jähriger Ehe verstarb. Die beiden Töchter kamen in Paris zur Welt. Kanal war mehrfacher Großvater.
Jerzy Kanal war eine der bedeutenden Persönlichkeiten des jüdischen Lebens im 20. Jahrhundert, als Zeuge der Schoa und als einer, der jüdisches Leben in Deutschland tatkräftig aufgebaut hat.
03.07.2015
 Berlin Berlin
Netzwerk gegen Antisemitismus
»NEBA«-Gründungskonferenz entwickelt Forderungskatalog für Bundestagsabgeordnete
Alice Lanzke
[…] Die Gründungskonferenz des Netzwerks fand in der Topographie des Terrors statt. Deren Direktor Andreas Nachama betonte in seiner Begrüßung, das Problem sei nicht der Antisemitismus der anderen, sondern der der Gesellschaft. »Antisemitismus ist ein Teil von uns«, sagte Nachama. »Die Gesellschaft muss in den Spiegel schauen und die hässliche Fratze des Antisemitismus erkennen.« […]
02.07.2015
Mitteilung Universität Paderborn
Text: Ingo Kalischek
Wie religiöse Vielfalt gelingen kann – Podiumsdiskussion widmete sich dem Zusammenleben verschiedener Glaubensrichtungen
Unsere heutige Gesellschaft ist geprägt von den verschiedensten Religionen: Längst leben Christen, Juden oder Muslime in vielen Teilen Deutschlands Tür an Tür. Immer wieder aber wird das Zusammenleben schwer erschüttert, besonders durch das Phänomen des religiösen oder pseudo-religiösen Terrorismus. Umso wichtiger ist es, Projekte und Ideen zu entwickeln, die ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. Einige wurden jetzt während einer Podiumsdiskussion der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) vorgestellt.

Winfried Verburg, Leiter (Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück / v. l.), Rabbiner Andreas Nachama (Vorstandsmitglied House of One), Bischof Anba Damian (Generalbischof koptisch-orthodoxe Kirche), Studierendenpfarrer Nils Petrat, Idris Nassery (Promovend Graduiertenkolleg Islamische Theologie Uni Paderborn) und Moderator Peter Fäßler (Geschichts-Professor Uni Paderborn)
Ein permanenter Ort des interreligiösen Dialogs soll in Berlin entstehen. Im Projekt „House of One“ wollen Juden, Christen und Muslime ein Haus errichten, unter dessen Dach eine Synagoge, Kirche und Moschee vereint sind. Rabbiner Andreas Nachama, Vorstandsmitglied des Projekts, reiste extra aus Berlin an und stellte die Idee während der Podiumsveranstaltung vor. Entstehen soll das Haus auf dem Petriplatz in Berlin Mitte. "Alle Religionen könnten dort Gottesdienste halten. Das wäre etwas weltweit Einzigartiges", freut sich Rabbiner Andreas Nachama.
[…] Auf die Frage von Moderator Peter Fäßler, Geschichts-Professor an der Paderborner Uni, ob der interreligiöse Dialog in Zukunft auch stärker die Basis erreichen werde, antwortete Rabbiner Andreas Nachama abschließend: "Die eigene Identität bildet sich an Fremdheitserfahrungen aus. Der interreligiöse Dialog kann nicht nur auf doktrineller Ebene stattfinden, sondern in der konkreten Auseinandersetzung mit den Menschen vor Ort."
16. Juni 2015

Judenfeindlichkeit in Deutschland
"Wir brauchen einen Antisemitismusbeauftragten"
Christian Böhme
Andreas Nachama von der "Topographie des Terrors" über Judenhass, Kommissionen, den Nahostkonflikt und die Grenzen der Israel-Kritik.
Herr Nachama, braucht eine Antisemitismus-Expertenrunde zwingend eine jüdische Perspektive?
Darum kommt man wohl kaum herum. Schließlich richtet sich der Hass der Antisemiten gegen Juden. Bei einer Kommission, die sich mit Islamfeindlichkeit beschäftigt, sollten ja auch sinnvollerweise Muslime beteiligt sein. In Deutschland gibt es etwa 100.000 Juden, die in Gemeinden organisiert sind. Auf ihre Einschätzung, ihre Erfahrungen mit antisemitischen Ressentiments kommt es an.
Dennoch sollte die neue Antisemitismus-Kommission des Bundesinnenministeriums zunächst ohne ein jüdisches Mitglied auskommen. Die Empörung war groß. Zu Recht?
Man kann schon sagen, dass dies ein Geburtsfehler des Gremiums war.
Das Innenministerium hat inzwischen eingelenkt: Die Psychologin Marina Chernivsky und Sie gehören nun zum Kreis der Fachleute. Was kann Andreas Nachama als Jude, Historiker und Rabbiner beitragen?
Das wird sich zeigen. Zunächst werde ich darauf drängen, dass die Betroffenen selbst befragt werden. Und zwar auf einer repräsentativen sozialwissenschaftlichen Basis. Zudem hat die Vorgängerkommission 2012 vernünftige Handlungsempfehlungen gegeben.
Es gibt seit langem den Vorwurf, dass praktisch nichts passiert sei. Ist die Kritik berechtigt?
Ja. Selbst dort, wo mit wenig Mitteln Programme und Instrumentarien zur Antisemitismus- und Vorurteilsprävention bekannt gemacht werden könnten, geschieht wenig.
Aber warum?
Das Problem der meisten Kommissionen ist: Wenn es niemanden gibt, der sich für die Umsetzung möglicher Beschlüsse einsetzt, dann verläuft das Ganze im Sande. Deshalb bin ich dafür, den Posten eines Antisemitismusbeauftragten zu schaffen. Der sollte vom Bundestag ernannt werden und den Auftrag haben, etwaigen Vorschlägen tatsächlich auch Taten folgen zu lassen. Womöglich wird dieses Amt ohnehin noch zu meinen Lebzeiten überflüssig. Das wäre schön.
Was stimmt Sie zuversichtlich, dass der Hass auf Juden in absehbarer Zeit nicht mehr existiert?
Der Antisemitismus ist ein unglaublicher Blödsinn. Das muss doch auch den dümmsten Judenhassern endlich klar werden. Ich glaube an die Belehrbarkeit der Menschen.
Aber Antisemitismus gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Daran hat sich bislang nichts geändert.
Das sehe ich anders. Vergleichen Sie einfach mal das Deutschland von 1932/33 und das heutige miteinander. Da sieht man schon: Einiges hat sich verändert – ohne dass der jetzige Zustand gleich als gut bezeichnet werden kann. Immerhin sind laut verlässlichen Umfragen zwischen 20 und 25 Prozent der Bundesbürger antisemitisch gesinnt. Aber dieser Befund hat auch etwas Gutes.
Wie das?
75 Prozent der Deutschen sind keine Judenfeinde. Das ist doch ein Fortschritt im Vergleich zu den 30er Jahren. Und wenn es so etwas wie einen Antisemitismusbeauftragten gäbe, könnte sich die Situation nochmals verbessern.
Inwiefern?
Weil er sowohl die jeweilige Regierung als auch die Öffentlichkeit für das Problem sensibilisieren würde. Ohnehin glaube ich, dass die Gesellschaft immer bunter wird – auch das wird positive Folgen haben, wenn es um den Abbau von Vorurteilen geht.
Wie gefährlich ist denn Judenfeindlichkeit?
Da gibt es zum Beispiel den Salon-Antisemitismus, der bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. In der Beschneidungsdebatte hat dieser sich deutlich artikuliert. Wenn man als Jude die geäußerten Ressentiments liest oder hört, dann tut das weh. Darüber hinaus gibt es einen Antisemitismus, der sich vorwiegend aus dem Nahostkonflikt speist – eine militante, zuweilen sogar terroristische Variante des Judenhasses, der zudem international aufgestellt ist. Aber der betrifft und bedroht nicht nur Juden, sondern die ganze auf Freiheit ausgerichtete Gesellschaft.
Und warum schreit diese Gesellschaft dann nicht auf, wenn in deutschen Städten "Jude, Jude, feiges Schwein" oder "Kindermörder Israel" skandiert wird?
Keine Frage, solche Slogans sind inakzeptabel. Aber wir brauchen nicht überrascht zu sein. Denn immerhin haben 25 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen antisemitische Ressentiments. Und wenn die glauben, ein Ventil gefunden zu haben, dann lassen sie ihrem Hass freien Lauf.
Wann wird denn aus legitimer Israelkritik Antisemitismus?
Wenn es zum Beispiel heißt: "Juden ins Gas". Wenn Israelis und hier lebende Juden in Kollektivhaftung für das Regierungshandeln in Jerusalem genommen werden. Wenn der jüdische Staat dämonisiert und delegitimiert wird. Wenn für Israel andere Maßstäbe gelten sollen als für jedes andere Land. Immer dann ist eine Grenze überschritten.
Andreas Nachama (63) ist seit 1994 geschäftsführender Direktor des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors in Berlin. Von 1997 bis 2001 war er Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.
22.05.2015

Nazi-Kunst aus der Reichskanzlei
Hitlers Bronzepferde sollen ins Museum
Thomas Loy
Was geschieht mit den riesigen Skulpturen und Reliefs aus dem spektakulären Nazi-Kunst-Fund? Kulturstaatsministerin Grütters votiert für eine Ausstellung in einem "öffentlichen Museum". Diskutiert werden nun zwei Standorte in Berlin.
Wohin mit Hitlers Bronze-Pferden? Andreas Nachama, Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, würde sie nehmen, aber nur für einen Sommer. Die Ausstellung zur Machtzentrale Wilhelmstraße, die im Depot der Topographie lagert, ließe sich, mit den Kunstwerken aus Hitlers Reichskanzlei angereichert, erneut auf der Freifläche des weitläufigen Geländes präsentieren. Immerhin sind die Werke der NS-Staatsbildhauer Arno Breker und Stefan Thorak die einzigen authentischen Relikte aus der Neuen Reichskanzlei an der Voßstraße/Ecke Wilhelmstraße, die nach dem Krieg gesprengt und abgeräumt wurde. […]
21.05.2015
 ja/epd ja/epd
Nachama und Chernivsky im Gremium
De Maizière beruft jüdische Experten in Antisemitismus-Kommission – Zentralrat begrüßt Entscheidung
Die Antisemitismus-Kommission der Bundesregierung wird um zwei jüdische Mitglieder erweitert. Das Bundesinnenministerium teilte am Donnerstag in Berlin mit, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) habe die Psychologin Marina Chernivsky und den Direktor der Stiftung »Topographie des Terrors«, Andreas Nachama, benannt. Die Berufung der beiden Experten sei mit allen Bundestagsfraktionen abgestimmt, hieß es.
»Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßt es ausdrücklich, dass nachträglich zwei jüdische Experten in die Antisemitismus-Kommission der Bundesregierung berufen wurden«, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. »Die Psychologin Marina Chernivsky kann direkt Erfahrungen aus der Praxis schildern, während der Direktor der Stiftung ›Topographie des Terrors‹, Andreas Nachama, auch wissenschaftliche Erkenntnisse beisteuern kann. Über Antisemitismus sollte nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg, sondern unter Einbeziehung der jüdischen Gemeinschaft gesprochen werden«, betonte Schuster.
[…]
Chernivsky leitet in der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland das Erwachsenen-Projekt »Perspektivwechsel – Bildungsinitiativen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit«. Nachama steht der »Topographie des Terrors« vor, dem Erinnerungs- und Ausstellungsort zum NS-Terror in Berlin.[…]
21.05.2015
, es/msh (KNA, epd) es/msh (KNA, epd) Germany adds Jews to anti-Semitism watchdog after criticism
The German government has confirmed that its new committee to promote the interests of Jewish Germans will now include Jewish members. The move follows backlash over failing to invite members with a Jewish background.
The German federal government announced on Thursday that its anti-Semitism committee would be adding two Jewish members to its ranks, following criticism for not having done so at its inception. A statement from the government said that Interior Minister Thomas de Maizère (CDU) had invited the psychologist Marina Chernivsky to join, as well as Andreas Nachama, director of the Topography of Terror Foundation, the organization which operates Berlin's museum on Nazi era. […]
28.05.2015

»Sehen, was wir bewegen können«
Andreas Nachama über Aufgaben und Besetzung des Antisemitismus-Expertenkreises
Detlef David Kauschke
Herr Nachama, Sie wurden vergangene Woche in den Expertenkreis Antisemitismus nachberufen, gemeinsam mit der Psychologin Marina Chernivsky. Ist das Ehre oder Pflicht?
Weder das eine noch das andere. Es hat sich eine interessante Konstellation ergeben. Mal sehen, was wir bewegen können.
Es war eine Nachberufung infolge heftiger Kritik: Die Expertenkommission sollte zunächst ohne jüdische Mitglieder auskommen. Wie bewerten Sie den Vorgang?
Ich denke, dass der Kommission bereits ausgezeichnete Wissenschaftler angehörten. Es hat sich aus dem Diskurs ergeben, dass nachgebessert werden sollte. Nun ist das geschehen. Ich würde das ganz pragmatisch sehen. So ist Politik nun einmal.
Was werden Sie als Historiker und Rabbiner nun beitragen können?
Als jüdische Kommissionsmitglieder können wir schon bestimmte Expertisen und Perspektiven einbringen. Und es wird denjenigen, die mich berufen haben, nicht verborgen geblieben sein, dass ich zwei Aufgaben habe. Seine Erkenntnisse bezieht man aus allen Quellen, die einem zur Verfügung stehen, also auch aus Gesprächen und persönlichem Erleben. Aber darüber hinaus finde ich, dass man endlich eine repräsentative Umfrage unter den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden machen sollte. Seit Jahrzehnten werden Umfragen durchgeführt, um festzustellen, wie groß der Anteil von Antisemiten in Deutschland ist. Jetzt sollte man auch einmal die Gemeindemitglieder befragen, inwieweit sie von Antisemitismus betroffen sind. Wir sind ja nicht mehr in den 70er-Jahren, als wegen der geringen Mitgliederzahlen so etwas schwer durchzuführen war. Heute haben wir mehr als 100.000 Gemeindemitglieder und könnten per Umfrage sicher sehr wichtige Erkenntnisse erlangen – und bestimmt auch sehr viel mehr Perspektiven und Ansichten, als wir jüdischen Kommissionsmitglieder allein einbringen können.
Die Vorgängerkommission hat 2012 ihren Bericht vorgelegt – mit beunruhigenden Erkenntnissen und etlichen Handlungsempfehlungen. Vermissen Sie die Umsetzung?
Der Bericht hatte eine hohe Qualität, war mit über 100 Seiten auch sehr umfassend. Es wurden die Formen des aktuellen Antisemitismus dargestellt und analysiert. Aber es gab eben auch mehr als 40 einzelne Handlungsempfehlungen. Und ich habe schon gelegentlich nachgefragt, wie es mit der Umsetzung aussieht. Da konnte mir noch nicht viel Konkretes genannt werden. Dass alle Empfehlungen vollständig umgesetzt würden, war nicht zu erwarten. Aber man hätte einiges wenigstens angehen können.
Wird sich das nun ändern?
Ich gehe davon aus, dass nicht nur Frau Chernivsky und ich, sondern auch die anderen Experten gemeinsam mit uns diese äußerst missliche Situation angehen werden.
Mit dem Direktor der Stiftung Topographie des Terrors und Rabbiner der Berliner Synagogengemeinde Sukkat Schalom sprach Detlef David Kauschke.
05.05.2015 
Estrongo Nachama Preis
Engagement für Toleranz
Rudolf Seiters, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, ausgezeichnet
epd
[…] Der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, Vorstandsmitglied der Stiftung Meridian und Sohn des Namensgebers des Preises, Andreas Nachama, erklärte, dass Toleranz und Zivilcourage leider noch immer nicht selbstverständlich seien.
Er verwies dabei auf einen Vorfall in einem Berliner Fußballstadion vor wenigen Tagen, als die Polizei das Zeigen einer israelischen Flagge untersagt hatte. »Es ist zwar Normalität, wenn Frauen ein Kopftuch tragen, aber das Tragen einer Kippa bleibt oftmals gefährlich. Darum muss das Verständnis für und die Offenheit gegenüber anderen Kulturen größer werden«, sagte Nachama.
28.04.2015 
Topographie des Terrors: Ein Porzellan-Bär zum Jubiläum
Ralf Schönball
Der Regierende Bürgermeister Michael Müller kam persönlich, um Daniela aus Österreich zu gratulieren. Die besuchte zufällig die Topographie des Terrors.
Dit is Berlin: Kurz mal vorbei schauen und mit einem Buddy-Bären aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur unterm Arm zurück nach Vöcklabruck. Daniela Schlagers Freunde im österreichischen Städtchen werden Augen machen. Und wer's nicht glaubt, findet bald auf der Webseite der Topographie des Terrors Fotos der zehnmillionsten Besucherin und der Ehrung durch Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller, mit festem Händedruck und freundlichem Blick aus der Tiefe der Brille. […] Eine Erfolgsgeschichte: Rund 1,3 Millionen Besucher kommen jährlich, sagt Nachama und er freut sich, die Wette mit Berlins früherem Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) gewonnen zu haben. Der hatte dem Stiftungschef vorgerechnet, dass Berlin jeden Besucher mit fünf Euro subventioniere; mit dem Neubau werde dies noch teurer.
Es geht um Sachlichkeit und Aufklärung
Heute sind es knapp drei Euro. Aber früher kamen auch nur 300.000 Besucher im Jahr zu der Topographie, die Bund und Land mit 2,8 Millionen Euro fördern. Weil sie dem „dark tourism“ anhängen, wie in angelsächsischen Ländern der genüssliche Schauder an Originalschauplätzen von Tod und Tragik genannt wird? „Den Begriff verwenden wir erst gar nicht“, sagt Burkhard Kieker von Visit Berlin – und erst recht inszeniere Berlin Geschichte nicht so. […]
15. April 2015

Neuer Vorstand für das Bet- und Lehrhaus
Rabbiner Andreas Nachama ist neues Mitglied im Vorstand des Vereins Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin. Er ist der Nachfolger von Rabbiner Tovia Ben-Chorin, der im Sommer Berlin verlassen wird. "Ich habe mich entschieden, hier mitzuarbeiten, bis das Haus steht", sagte Nachama nach seiner einstimmigen Wahl. Das House of One ist ein Haus, das Juden, Christen und Muslime gemeinsam mit Spendengeld auf dem Petriplatz erbauen wollen. Unter seinem Dach werden sich eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee befinden. Ein zentraler Raum dient dem Austausch der Religionen.
17. April 2015


Titelbild: Andreas Nachama (l.) wird Nachfolger von Rabbi Tovia Ben-Chorin.
Bild: Benita Dill
Ein neuer Vorstand für House of One
Manfred Wolf
Aufgrund seines Weggangs aus Berlin ist Rabbiner Tovia Ben-Chorin Ende März aus dem Vorstand des Trägervereins des House of One ausgeschieden. Der bekannte Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama, 1951 in Berlin geboren, seit 1995 Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, löst Rabbiner Ben-Chorin im Vorstand ab. Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama wurde vom Abraham Geiger Kolleg entsandt und in der letzten Vorstandssitzung einstimmig gewählt. „Ich habe mich entschieden, hier mitzuarbeiten, bis das Haus steht“ so Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama nach seiner Wahl.
Gemeinsames suchen
„Wir sind sehr glücklich über die Zusage von Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama, im Vorstand unseres Trägervereins mitzuwirken und zugleich sehr traurig, dass unser Freund und Rabbiner Tovia Ben-Chorin uns verlässt – auch wenn er dem House of One mit Rat und Tat verbunden bleibt“, sagte Gregor Hohberg, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde St. Petri-St. Marien, ebenfalls Vorstandsmitglied des Vereins. „Unsere Generation soll Gemeinsames suchen und über Trennendes hinweg ein Haus errichten, um in verschiedenen Glaubensweisen auf der Suche zu bleiben nach Wegen zu IHM“, so Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama zu der Frage, warum er sich entschieden hat, dem Vorstand des House of One beizutreten. Rabbiner Nachama wird im Wesentlichen die Arbeit von Rabbiner Ben-Chorin fortführen und die weitere Entwicklung des House of One vorantreiben. Rabbiner Tovia Ben-Chorin hatte die Arbeit des House of One seit Beginn der Gründung des Trägervereins im September 2011 in seiner humorvollen, unnachahmlichen Weise und hoher theologischer Kompetenz maßgeblich mitgeprägt.
Das House of One ist ein Haus der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam, das mithilfe von Spendengeldern im Zentrum Berlins errichtet wird. Das Besondere: Juden, Christen und Muslime bauen es gemeinsam. Unter seinem Dach befinden sich eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee. Ein zentraler Raum in der Mitte lädt zum Austausch und Kennenlernen von Menschen unterschiedlicher Religionen ein, offen auch für diejenigen, die den Religionen fernstehen. Das House of One setzt sich weltweit für ein friedvolles Miteinander ein und fördert den Dialog der Religionen und Kulturen.
Promovierter Historiker
Der in Berlin geborene Nachama ist seit 1995 Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Von 1997 bis 2001 verantwortete er die Geschicke der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.Seit 2001 ist der promovierte Historiker Rabbiner der Synagogengemeinde Sukkat Schalom und seit 2007 auch Professor für Holocaust am Touro College Berlin/New York.
16.04.2015

Landesrabbiner der DDR
Eine Gedenktafel erinnert an Martin Riesenburger, der den ersten Gottesdienst nach der Schoa in Berlin hielt Christine Schmitt
Bis zu diesem Moment wusste kaum einer der Passanten, wer Martin Riesenburger war«, sagte Pfarrer Carsten Unbehaun am Dienstag in Berlin-Hellersdorf. Bislang trug das Straßenschild, das inmitten einer Plattenbausiedlung steht, lediglich den Namen. Daher hatten Unbehaun und die evangelische Gemeinde Hellersdorf beim Bezirksamt einen Antrag gestellt, dass eine Gedenktafel mit weiteren Angaben unter dem Straßenschild angebracht wird. Das sollte an Riesenburgers 50. Todestag, dem 14. April, geschehen. [...] »Riesenburger war ein Rabbi der besonderen Art«, sagte Andreas Nachama, Rabbiner der Synagogengemeinde Sukkat Schalom und Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Nachama, der Riesenburger persönlich kannte, erinnerte an Lebensstationen des Rabbiners.
Biografie
1896 wurde Martin Riesenburger in Berlin geboren. Er studierte Religionsphilosophie und Musik. Seine Frau Clara arbeitete im Jüdischen Altersheim als Friseurin. Zunächst wurde Riesenburger Konzertpianist. »Er war aber auch Religionslehrer und besuchte die Älteren im Altersheim in der Großen Hamburger Straße und im Jüdischen Krankenhaus«, berichtete Nachama. Während der NS-Zeit, als sich die älteren Juden nicht mehr auf die Straße trauten, habe Riesenburger Konzerte für sie gegeben und dabei gemerkt, wie wichtig seelsorgerische Begleitung ist. »Er fand so die Erfüllung seines Lebens.«
[…] 1943 wurde er zur Zwangsarbeit auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee eingeteilt. Während dieser Zeit habe er Flüchtlingen geholfen, Gottesdienste gehalten, Begräbnisse organisiert und Torarollen gerettet, so Nachama. [..] Nachama zitierte bei der Feier in Hellersdorf, an der auch Riesenburgers ehemalige Religionsschülerin Eva Nickel teilnahm, Selbstzeugnisse und Predigten des Rabbiners. Anschließend wurde Riesenburgers an seinem Ehrengrab auf dem Friedhof Weißensee gedacht.
17.04.2015

Martin-Riesenburger-Straße: Zusatztafel nennt Lebensstationen des Rabiners
Harald Ritter
Hellersdorf. Nach Martin Riesenburger wurde bereits 1987 eine Straße benannt. Seit Mitte April erläutert eine Zusatztafel am Straßenschild an der Ecke Mark-Twain-Straße die Bedeutung des Rabbiners für Berlin. […] Gast der Ehrung war aber Andreas Nachama. Der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors und Rabbiner der Synagoge "Sukkat Schalom",[…]. Er konnte bewegend aus dessen Leben erzählen. Martin Riesenburger (rechts) bei einem Chanukka-Fest um 1950. Als Rabbiner trug er zur Wiederbelebung jüdischen Lebens in Berlin bei.
 (Foto: privat) (Foto: privat)
26. März 2015

Griechenland
Eine Frage der Moral
Es geht nicht um Reparationen. Wichtig ist eine Geste der Versöhnung mit den Opfern und ihren Nachkommen
Rabbiner Andreas Nachama
Durch die Gazetten geistern im Zusammenhang mit Griechenland merkwürdige Begriffe: Restitution einer NS-Zwangsanleihe, NS-Opferdörfer, Entschädigung für erlittenes NS-Unrecht und Grexit. Aber vor allem begegnen uns »diebische« Griechen, die »wortbrüchig« oder »ökonomisch unfähig« sind. Kaum einer fragt nach den durch den fiskalischen Tsunami um ihre Existenz und Zukunft gebrachten griechischen Menschen. Gäbe es heute noch einen Hofprediger, so würde er heute wohl formulieren: »Die Griechen sind unser Unglück!« Man könnte es Anti-Hellenismus nennen.
Wer vermag wirklich einzuschätzen, ob die gleichen ökonomischen Regeln, die im wirtschaftlich prosperierenden Deutschland zu Wohlstand führen, auch in Griechenland gelten können? Zumal der Beitritt in eine Währungsunion zu allen Zeiten dazu geführt hat, dass ein großes Stück der Souveränität eines Landes aufgegeben wird.
Die große wirtschaftliche und menschliche Not dieser Jahre führt nun dazu, dass sich viele in Europa Gedanken darüber machen, welche Wege aus dem Elend sich auftun könnten. Da kommen den Protagonisten in Griechenland verübtes NS-Unrecht und die deutsche Besatzung in den Sinn.
Zivilbevölkerung
Der griechische Widerstand hat so wenig wie der polnische oder französische die verhasste deutsche Besatzung beenden können. Aber er hat dazu geführt, dass die deutsche Besatzungsmacht sich legitimiert sah, durch mörderische Vergeltungsaktionen gegen die griechische Zivilbevölkerung großes Leid anzurichten. Diese Geiselmorde und Erschießungen waren Gegenstand einer der zwölf Nürnberger Nachfolgeprozesse 1947/48.
Dass die Wehrmacht überhaupt auf dem Balkan auftauchte, liegt am erfolgreichen Kampf der griechischen Armee gegen Mussolini-Italien. Mein Vater, Estrongo Nachama, der in Saloniki geborene langjährige Berliner Oberkantor, war sein Leben lang stolz, als griechischer Fernmeldesoldat mit der »Waffe in der Hand« gegen die Faschisten aus Italien und Deutschland lange Zeit erfolgreich gekämpft zu haben. Da Hitler aber keine Achsenmacht untergehen lassen wollte, kam die Wehrmacht den bedrängten Italienern zu Hilfe und besetzte Teile des Balkans und Griechenlands.
Durch diese NS-Besatzung Griechenlands kam es zu dem in diesen Tagen oft beschriebenen NS-Zwangskredit, den die Griechen zur Finanzierung ihrer eigenen Besatzung an Berlin geben mussten. Das muss man so verstehen, wie die eine Milliarde Reichsmark, die die deutschen Juden an den NS-Staat nach dem Novemberpogrom zu zahlen hatten. Die Geschädigten hatten nicht nur den Schaden, sondern mussten ihn auch noch mit Geld an den NS-Fiskus ein weiteres Mal finanzieren. Nach der gleichen Logik musste das NS-besetzte Griechenland nicht nur die Wehrmacht im Land ertragen, sondern auch noch deren Besatzungslasten erstatten.
Geste
Ob die Rückzahlung dieses Kredites oder, allgemeiner gesagt, Reparationen, nach dem Abschluss des Zwei-plus-Vier-Vertrages und der Kenntnisnahme dieses Vertrages durch die OSZE-Staaten, also auch Griechenland, völkerrechtlich überhaupt zur Diskussion steht, kann als unwahrscheinlich angesehen werden. Genauso wie der rechtliche Anspruch auf Entschädigung von Zwangsarbeitern zu Beginn des Jahrtausends. Und doch war die Gründung der »Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft« (EVZ) eine großartige humanitäre Geste den ehemaligen Zwangsarbeitern gegenüber.
Bei der historischen Rede und der Initiative von Bundespräsident Gauck bei seinem Staatsbesuch 2014 in Griechenland und dem aktuellen Anstoß von Renate Künast und anderen Politikern geht es eben nicht um Reparationen nach dem Völkerrecht, sondern um den moralischen Maßstab, den sich Deutschland mit seinen auf einzelne Personen, also auf die Opfer und nicht auf die Staaten, bezogenen Entschädigungsbemühungen in den letzten Jahrzehnten selbst gesetzt hat.
Für ein solches Versöhnungswerk könnte tatsächlich die im Jahr 2000 gegründete Stiftung EVZ Vorbild sein. Sie hat unbürokratisch und direkt die noch verbliebenen Opfer mit Geld bedacht. Damals hat eine große Zahl von deutschen Firmen, die in der NS-Zeit von Zwangsarbeit profitiert haben, in den Stiftungsfonds eingezahlt. Jetzt könnte man fragen, wer soll in eine solche deutsch-griechische Versöhnungsstiftung einzahlen, wer hat denn von der Besetzung Griechenlands profitiert?
Projekte
Dabei geht es nicht um Reparationen, sondern um eine Geste der Versöhnung den Opfern und ihren Nachfahren gegenüber. Eine solche Stiftung könnte ergänzt werden durch ein deutsch-griechisches Jugendwerk und gemeinsame auf die Zukunft bezogene Erinnerungsprojekte.
Ich kann mir kein Europa ohne Griechenland vorstellen. Das Wort Europa ist (alt)griechisch, und abgesehen von der Bibel war es doch die griechische Philosophie von Aristoteles bis Diogenes, die europäisches Denken und auch unsere Mentalität prägten und prägen. Europa und auch der Euro basieren nicht nur auf wirtschaftlichen und juristischen Regeln. Auch das ist ein Appell an die Politik, es nicht nur bei Vergangenheitsbewältigung zu belassen, sondern Wege zu finden, die in eine gemeinsame Zukunft mit Griechenland auf Augenhöhe führen.
 Salzkörner,
Sonderausgabe 2015 Salzkörner,
Sonderausgabe 2015
Warum ist mir der christlich-jüdische Dialog wichtig?
Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama, Berlin
In West-Berlin geboren und aufgewachsen gehörten zum engsten Umfeld meiner Eltern christliche Frauen und Männer, die ganz wesentlich und durch ihren persönlichen Einsatz dazu beigetragen haben, dass meine Mutter, die zwei Jahre und zwei Monate von der Fabrik-Aktion am 27. Februar 1943 bis zur Befreiung Berlins am 2. bzw. 8. Mai 1945 als Jüdin versteckt leben musste, überleben konnte. Deren Glaubensweise war anders, aber doch waren es die gleichen 10 Gebote, deren Feiertage waren anders, und doch war es die gleiche Ethik. Die Psalmen waren die gleichen, aber doch haben sie sie anders ausgelegt, die Bibeltexte der hebräischen Bibel waren die gleichen, aber doch wurden sie oftmals in einen anderen Kontext gestellt. Das hat mich schon früh fasziniert und neugierig gemacht. Und so gehörte ein Diskurs mit ihnen schon früh zu dem, was einen wesentlichen Teil meines Lebens ausmachte.
Im Studium hatte das Berliner Institut für Judaistik, die Evangelische Theologie, das Institut für Religionswissenschaften, das Institut für Islamwissenschaft und das Institut für katholische Theologie damals in weiten Teilen ein gemeinsames Grundstudium. Ich fand es faszinierend, jüdische Glaubensstrukturen oder -inhalte im Diskurs mit Pfarramtsstudenten oder zukünftigen Religionswissenschaftlern neu zu verstehen - und bin mir sicher, den nichtjüdischen Kommilitonen ging es nicht anders.
Dann wurde mir klar, dass es diesen Diskurs erst wenige Jahre gab, dass Religionsgespräche zwischen Christentum und Judentum vorher nicht auf Augenhöhe stattfanden, sondern fast immer nur ein Ziel hatten: den Christen in seinem staatlich sanktionierten Religionsverständnis über die anderen minoritären Glaubensgemeinschaften obsiegen zu lassen, Kreuzzüge, Inquisition, Lügenbezichtigung um des vermeintlichen Rechthabens willen.
Und nun studierten wir mit Helmut Gollwitzer, Friedrich-Wilhelm Marquardt, Fritz Steppat, Jacob Taubes und Marianne Awerbuch in einem kleinen akademischen Paradies und gingen gemeinsamen biblischen Quellen, kirchlich-antijüdischen Polemiken und unterschiedlichen religiösen Lebenswelten nach. Deutlich wurden gemeinsame Probleme von Judentum und Christentum in Zeit und Raum: Wie sich aus der alten israelitischen Opferkultreligion in der Tradition der prophetischen Kritik an Priestern und Israeliten nach der Zerstörung des Tempels zwei moderne Glaubensweisen herausbildeten - das rabbinische Judentum, das die Erinnerung an den Tempel in Worte des Andenkens transformierte und das Christentum, das sich zur Erinnerung an Jesus von Nazareth aufstellte. Die einen führen den ewig bestehenden Bund nicht mehr auf Jerusalem bezogen in neuem Gewand universal weiter, die anderen werden auch universal, aber setzen einen neuen Bund daneben: Geschwister im Glauben, Konkurrenten in der Realität.
Der christlich-jüdische Dialog nach der Schoa hat auch zu verfassten christlich-jüdischen Dialogkreisen geführt, zu Gemeinschaftsgottesdiensten und nicht mehr wegzudenkenden Begegnungen auf Kirchen- und Katholikentagen und festverankerten Foren in den laizistischen Organisationen wie dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder der EKD-Synode. Man könnte sich über alles dies freuen, wenn nicht in den unbestimmten Weiten des weltweiten Netzes und einer gedankenlosen Öffentlichkeit, wenn nicht zum Beispiel durch den rauen Ton in der Beschneidungsdebatte oder in der Beurteilung nahöstlicher Gefahrszenarien für die in islamischen Ländern und Israel lebenden Christen das Potential läge, das junge Pflänzchen des christlich-jüdischen Dialogs auf dem Altar der vorauseilenden Gehorsamkeit gegenüber einer scheinbaren politischen Correctness, die in Wirklichkeit die Abhängigkeit von nahöstlichem Öl paraphrasiert, zu opfern.
Und da stehen wir heute und sollen nicht anders können: anders als in den letzten 2000 Jahren wollen wir Gemeinsames suchen und führen und über Trennendes hinweg Dialog versuchen. Für unsere Zeit und alle neuen Zeiten wollen wir im Dialog bleiben, um in verschiedenen Glaubensweisen auf der Suche zu bleiben nach Wegen zu IHM.
5. März 2015

Hinter der Mauer
Rabbiner Andreas Nachama
Purim ist ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Fest, das am 14. Adar (an diesem Donnerstag) gefeiert wird – in manchen Orten aber auch einen Tag später. Grundsätzlich werden in der Diaspora viele jüdische Feste an zwei Feiertagen hintereinander begangen – anders als in Israel.
Bei Purim verhält es sich in gewisser Weise umgekehrt. In der Diaspora wird das Fest an einem einzigen Tag gefeiert, in Israel aber an zwei Tagen. Dabei handelt es sich nicht um einen Übermittlungsfehler im Kalender oder gar um eine Panne der rabbinischen Logik, sondern es steht so in der Megilla: »Die Juden in den königlichen Provinzen scharten sich zusammen, verteidigten ihr Leben, verschafften sich Ruhe vor ihren Feinden und ermordeten von ihren Hassern 75.000 Mann; aber nach der Beute streckten sie ihre Hand nicht aus. Das geschah am 13. Tag des Monats Adar, aber am 14. ruhte man und feierte ihn als einen Tag fröhlicher Gelage. Dagegen scharten sich die Juden in Susa am 13. und am 14. zusammen, ruhten am 15. und feierten ihn als einen Tag fröhlicher Gelage« (Buch Esther 9,12–18).
Da Schuschan oder Susa, die Hauptstadt des biblischen Landes, eine ummauerte Stadt war, haben die Rabbinen verfügt, dass Juden, die in ummauerten Städten leben, erst am 15. Adar Purim feiern. Das heißt für Israel: Das ganze Land feiert wie der Rest der jüdischen Welt am 14. Adar Purim, in Jerusalem aber wird Purim erst am 15. Adar (an diesem Freitag) gefeiert.
Bezirke Jetzt könnte man sehr schnell auf die Idee kommen, dass diese Vorschrift auch auf andere ummauerte Städte zu übertragen sei. Ich erinnere mich gut daran, dass besondere Schlaumeier in regelmäßigen Abständen im ummauerten West-Berlin mit der Forderung auftauchten, dass Purim erst am 15. Adar zu feiern sei, weil West-Berlin als Eruv gelte, als geschlossener Bezirk am Feiertag.
Tatsächlich hätte man West-Berlin als Eruv betrachten können – möglicherweise haben es auch einige getan, denn die Stadt war vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 gänzlich ummauert beziehungsweise durch nahezu unüberwindbare Stacheldrahtzäune von der östlichen Stadthälfte und vom Umland getrennt.
Die Grundregel für Juden, die den Schabbat halten, ist, dass man keine Lasten vom privaten in den öffentlichen Bereich tragen darf. Wohl aber darf man zum Beispiel in einer durch die Eingangstür verschlossenen Wohnung zum Beispiel Teller oder Tiegel mit Essen von der Küche ins Esszimmer bringen – oder den Kinderwagen vom Kinderzimmer ins Wohnzimmer rollen. Diese Regel wird auch auf ummauerte Städte oder Stadtbezirke angewendet. In einer ummauerten Stadt darf eine praktizierende Jüdin ihren Kinderwagen nicht nur von Zimmer zu Zimmer in ihrer Wohnung rollen, sondern damit auch in die Synagoge spazieren, wenn die örtliche jüdische Gemeinde oder ein Rabbiner feststellt, dass die Gegebenheiten des Eruv erfüllt sind.
Baumstämme Jeder von uns hat schon einmal diese scheußlichen, meist auf Baumstämmen angebrachten Telefon- und Stromleitungen in den Städten der USA gesehen, die beim ersten Orkan des Jahres umstürzen und zu Blackouts in amerikanischen Städten führen. Mir ist zwar unverständlich, warum ein modernes Amerika so seine Infrastruktur einrichtet – aber für Juden in Amerika sind diese Leitungen wunderbare virtuelle Mauern, die ihren Stadtbezirk oder ihre Stadt vom Umland trennen, also halachisch wie eine Mauer wirken.
Zurück nach West-Berlin in den Jahren zwischen 1961 und 1989: Hier gab es einige, die die Berliner Mauer als Eruv betrachteten, die also mit Kinderwagen vorneweg oder Gebetbuch unter dem Arm in die Synagoge gingen – auch über Distanzen hinweg, die am Schabbat ohne Pause eigentlich nicht zu bewältigen sind.
Besserwisser Andere dagegen wollten die Teilung der Stadt nicht akzeptieren und gingen folglich davon aus, dass auch West- und Ostgemeinde nicht geteilt seien. Folglich erkannten sie keinen Eruv für West-Berlin an.
Doch diese Diskussion war müßig, denn an Purim gelten ganz andere Vorschriften als die des Eruv. Schon im Talmud wird erörtert, wie das Fest zum Beispiel in Tiberias zu halten ist: Die Rabbinen gehen davon aus, dass die Stadt erst später eine Mauer erhielt – und legten fest, dass nur Großstädte, die schon zur Zeit von Jehoschua, also zur Zeit der Landnahme, ummauert waren, das Purimfest am 15. Adar feiern (Talmud Bawli, Megilla 2a). In heutigen Zeiten trifft dieses Kriterium nur noch auf Jerusalem zu. Zur Zeit der Berliner Mauer bekamen diese Besserwisser, die in regelmäßigen Abständen auf eine Verlegung des Purim in West-Berlin vom 14. auf den 15. Adar plädierten, genau diese Antwort von Rabbinern.
Billigflieger Falls man es allerdings heute darauf anlegt, kann man auch als Berliner Jude Purim im gleichen Jahr zweimal erleben – wenn man erst in Deutschland feiert und in der Synagoge die Megilla liest, am frühen Nachmittag einen Flieger nach Israel nimmt und sich dann am Abend und dem folgenden Tag, dem 15. Adar, in Jerusalem ins Festgeschehen stürzt.
Das wiederum war vom alten West-Berlin aus kaum möglich, da es keine direkten Flüge nach Israel gab. Im Zeitalter der Billigfluglinien dagegen ist die doppelte Purimfeier machbar – und auch halachisch kein Problem, Denn Purim ist zwar ein fröhliches Fest, aber kein durch Arbeitsverbote geschützter Schabbat oder Feiertag. Purim Sameach!
26.02.2015

Kurzbiografien
Undeutsche Komiker und Mütter der Nation
In »Wir Berliner!« stellen 33 Promis von heute ebenso viele Promis von gestern vor
Harald Loch

[...] Estrongo Nachama
Ganz anders Estrongo Nachama (1918–2000), der als Überlebender von Auschwitz von 1947 bis zu seinem Tode Kantor der Jüdischen Gemeinde zu Berlin war. Er ist im griechischen Thessaloniki geboren und blieb zeitlebens griechischer Staatsangehöriger. Das ermöglichte ihm auch die Betreuung der Gemeinde in Ost-Berlin. Sein Sohn Andreas würdigt seine disziplinierte Arbeit, die der Vater nicht preußisch sondern im Dienste der ihm in der Synagoge anvertrauten Menschen versah. [...]
12.02.2015 
Vergelt's Gott
Rache sollte man dem Ewigen überlassen. In dieser Welt muss Entschädigung geleistet werden
Rabbiner Andreas Nachama
Wer seinen Nächsten verwundet, hat dafür zu zahlen, schreibt der Talmud.
Nachdem die Kinder Israels im vergangenen Wochenabschnitt die Zehn Gebote empfangen haben, geht es nun um Rechtsvorschriften. Mosche erhält von Gott die Anweisung, den Israeliten Gesetze vorzulegen. Die aus der Sklaverei Entronnenen bekommen nicht nur die Zehn Gebote, eine Grundordnung für das menschliche Zusammenleben, sondern auch ein Gesetzbuch für das Alltägliche. 53 der 613 in der Tora enthaltenen Ge- und Verbote fallen auf den Wochenabschnitt Mischpatim – nicht weniger als neun Prozent.
Dabei gibt es auch Neuerungen, die unsere Welt, würden sie konsequent angewendet, erheblich lebenswerter und menschlicher machen könnten. Sie würden es aber auch nötig machen, sich von Berichten abzuwenden, die an anderen Stellen im Tanach beschrieben werden: So lesen wir im 1. Buch Mose von dem Rachefeldzug, den Levi und Simeon, zwei Söhne Jakows, unternahmen, weil man ihre Schwester Dina vergewaltigt hatte. Sie überfielen die Stadt der Schechemiten und erschlugen alle Männer.
Hier wurden aus Rache für die Vergewaltigung der Schwester in großer Zahl Fremde erschlagen. Der greise Stammvater Jakow sprach zu Simeon und Levi: »Ihr bringt mich ins Unglück, da ihr mich bei den Kanaanitern und Perissitern, den Landeseinwohnern, verhasst gemacht habt. Wir sind ja nur klein an Zahl; sie werden sich gegen mich zusammenrotten und mich erschlagen, und ich werde samt meinem Haus vernichtet« (1. Buch Mose 34,30). Der Patriarch tadelt zwar den unangemessenen Rachefeldzug, doch er tut es allein deshalb, weil seine Familie zahlenmäßig unterlegen ist.
Ersatz
Im Abschnitt Mischpatim wird ein anderer Weg propagiert: »Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme! (...) Wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er die Person als Ersatz für den Zahn freilassen« (2. Buch Mose 21, 24–27).
Awraham Ibn Esra (1092–1167) merkt zu der Textstelle an: »Wenn der Täter ein armer Mann ist, wie kann dann Entschädigung aussehen? Würde ein Blinder einem anderen ein Auge ausstechen, was könnte man ihm dann noch tun? Der Arme könnte zu Geld kommen und dann doch seine Entschädigung zahlen, aber der Blinde könnte es niemals tun.«
Die Schrift meint deshalb immer Entschädigung und nichts anderes. Der unbegrenzte, auf die ganze Sippe oder Ortschaft der Täter ausgedehnte Rachefeldzug der Söhne Jakows aus dem 1. Buch Mose wird durch das gänzlich andere Rechtsprinzip der Entschädigung ersetzt.
Rabbi Élie Munk (1900–1981) merkt an: Auch dort, wo auf Mord die Todesstrafe steht, ist sie nur symbolisch. Munk bezieht sich hierbei auf die Schöpfungsgeschichte: »Wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, werdet ihr sterben« (1. Buch Mose 2,17). Es war ein anderes Leben, das Adam und Chawa damals führten – »sterben« bedeutete in ihrem Fall nicht das Lebensende.
Schmerzensgeld
Im Talmud wird das Symbolhafte der Strafe weiter ausgeführt: »Wer seinen Nächsten verwundet, hat fünf Zahlungen zu leisten: Schadenersatz, Schmerzensgeld, Kurkosten, Versäumnisgeld und Beschädigungsgeld. Wenn er ihm ein Auge geblendet, eine Hand abgehauen oder einen Fuß gebrochen hat, so betrachte man ihn als einen auf dem Markt zu verkaufenden Sklaven und man schätze, wie viel er vorher und wie viel er jetzt wert ist« (Bava Kama 83b–84a).
Rache wird also durch materielle Entschädigung ersetzt, die nach Regeln festgelegt ist. Die Rabbinen verwerfen ganz prinzipiell die irdische Rache. In Joma 23a heißt es: »Wenn jemand einen ersucht, ihm eine Sichel zu borgen und dieser ablehnt, worauf umgekehrt am folgenden Tag er jenen ersucht, ihm eine Axt zu borgen, und der erste erwidert: ›Ich borge dir nichts, weil du mir nichts geborgt hast‹, dann ist das Rachsucht.«
Die Rabbinen setzen einen Toravers dagegen: »Sei nicht rachsüchtig und trage den Söhnen deines Volkes nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst: Ich bin der Ewige!« (3. Buch Mose 18,19). Und sie ergänzen ihn mit dem Psalmwort: »Verherrlichung dem Gott meines Heils! Dem Gott, der mir Rache gibt und Völker unter mich zwingt, der mich vor Feinden schützt« (Tehilim 18, 47–49).
Taten
Bei Gott ist die Rache sehr gut aufgehoben. Er ist gerecht, und wer vor ihn tritt, wird nach seinen Taten beurteilt. Mir persönlich ist wohl dabei, dass die Rache bei Gott ist. Rache ist kein jüdisches Konzept für diese Welt, sondern sie wird schon in der Bibel dem Walten Gottes überantwortet. In den Worten von Rabbi Papa: »Der Mensch, der Rache übt, zerstört sein Heim« (Sanhedrin 102b).
Die chassidische Paraphrase des Bibeltextes nach Rabbi Menachem Schneerson (1902–1994) schafft endgültig Klarheit: »Eine Entschädigung muss gezahlt werden: Der Wert eines Auges für ein Auge, der Wert eines Zahns für einen Zahn …« Was also hier auf der Welt zu regeln ist, das legen Gerichte im Sinne von Strafmaß und Entschädigung fest.
Der Autor ist Rabbiner der Berliner Synagoge Sukkat Schalom.
9. Februar 2015

Karen Noetzel
Unwürdiger Zustand: Kritik am Gedenkort auf dem Güterbahnhof Moabit
Moabit. Am 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee hat der Historiker und Jurist Alfred Gottwaldt sein Buch über den Mahnort Güterbahnhof Moabit vorgestellt.
Vom ehemaligen Güterbahnhof gingen die meisten Transporte ab. Von dort aus wurde die größte Zahl jüdischer Menschen deportiert. Der "Zufuhrweg" von der Quitzowstraße zum Gleis, wo die Züge in den Tod warteten, existiert noch weitgehend im Originalzustand. Auch das Gleis ist noch vorhanden. Es wurde allerdings nach dem Krieg durch neue Schienen ersetzt.
Sowohl für Gottwaldt als auch für den Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, Andreas Nachama, der zum Vortrag in das Dokumentationszentrum an der Niederkirchnerstraße eingeladen hatte, ist der Zustand des Ortes "ungepflegt und eigentlich unbefriedigend". Der etwa sechs Meter breite und 50 Meter lange Weg sei vermüllt, kritisiert Gottwaldt. Schließlich seien von Moabit bis zu 30 000 Menschen deportiert und die meisten ermordet worden.
Die Stiftung Topographie des Terrors hatte 2007 auf dem Gehweg an der Einmündung in die Quitzowstraße eine provisorische Informationstafel installiert. Die Stele war nur als erster Schritt hin zu einem würdigen Mahn- und Gedenkort gedacht. Die Tafel wird heute von Kleidercontainern bedrängt. Geschehen ist nichts. Andreas Nachama: "Ein Discounter und ein Baumarkt prägen die Szenerie."
[…]
Gemeinsam mit einer bezirklichen Kunst-am-Bau-Kommission und einem Expertengremium, dem auch Andreas Nachama angehört, hat die Kulturstadträtin die Modalitäten für einen künstlerischen Wettbewerb zur Neugestaltung des Ortes erarbeitet. Das Land Berlin finanziert die rund 50 000 Euro teure Durchführung des Wettbewerbs, die Stiftung Deutsche Klassenlotterie soll den Bau bezahlen. Einen entsprechenden Antrag hat der Bezirk gestellt. Andreas Nachama zeigt sich "verhalten optimistisch".
Di 27.01.2015
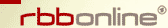 | 07:05
| 07:05
Nachama: 'Das Interesse der jungen Generation nimmt zu'
Siebzig Jahre nach der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz sieht der Direktor der Berliner Stiftung "Topographie des Terrors", Nachama, kein schwindendes Interesse an der Geschichte. Auch in der jungen Generation gebe es nach wie vor eine große Bereitschaft, sich mit den NS-Taten auseinanderzusetzen, sagte Nachama am Dienstagmorgen im rbb-Inforadio. Mit dem wachsenden zeitlichen Abstand werde das Interesse immer größer.
Die Ereignisse zwischen 1933 und 1945 seien so unverständlich, so dass die Frage nach dem warum bleibe und junge Menschen sehr stark beschäftige.
Auch in der Vergangenheit habe es immer einen Anteil von 20 bis 25 Prozent unter den Deutschen gegeben, die den Holocaust hinter sich lassen wollten. Er glaube nicht, dass dieser Prozentsatz steige, so Nachama. Siebzig Jahre nach dem Ende des Naziterrors im KZ Auschwitz müsse die Erinnerung wachgehalten werden. Denn Strukturen des Dritten Reichs lebten in manchen Staaten weiter, so Nachama. Mancherorts gebe es immer noch Menschenrechtsverletzungen und Polizeiwillkür. […]
25. Januar 2015 
Triumpf des Lebens
Andreas Nachama
Hätte vor 70 Jahren einer behauptet, dass sich im vom Nationalsozialismus befreiten Deutschand wieder jüdisches Leben entwickeln würde, man hätte ihm zu Recht nicht geglaubt. Über die Jahrzehnte der Teilung Deutschlands in Ost wie West legten kleine jüdische Gemeinden mit Überlebenden der Schoa Grundsteine für eine Renaissance nach der Vereinigung. In diese Gemeinden konnten später etwa hunderttausend russischsprachige Juden nach Deutschland immigrieren und heute wohnen in Berlin auch mehrere tausend junge Israelis. Das mutet wie ein Wunder an – ein Triumpf des Lebens, der Demokratie und der Toleranz.
Aber wirft man von außen einen Blick auf jüdische Schulen oder Gemeindezentren, man könnte meinen, man stünde vor dem Stuttgart-Stammheimer Hochsicherheitstrakt. Aufmerksame Zeitungsleser finden gelegentlich Nachrichten, von Kipaträgern, die mitten in Berlin angegriffen oder beleidigt werden. Und doch – beides hat mehr mit dem nahöstlichen Terrorismus zu tun als mit unserer Mainstreamgesellschaft.
Jüdisches Leben in Berlin, das sind genauso schlecht oder gut gefüllte Synagogen wie Kirchen, das ist jüdische Gläubigkeit, die sich im gleichen Säkularismus behaupten muss, wie evangelische oder katholische Gemeinden. Jüdisches Leben in Deutschland ist geprägt von einer gewissen Selbstverständlichkeit – man gehört dazu und ist Teil der Gesellschaft. Die Situation in Frankreich wird in der jüdischen Gemeinschaft mit Sorge wahrgenommen, freilich weiß man, dass die Mehrzahl der französischen Juden wie ihre benachbarten Feinde aus dem Magreb stammen, und die Konflikte dort weniger europäisch als eben nahöstlich geprägt sind.
Es wäre oberflächlich, wenn man Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft nicht wahrnehmen würde. Umfragen aus den letzen fünf Jahrzehnten belegen, dass er leider nie unter 20 und glücklicherweise nie über 25 Prozent der Befragten lag.
Bleibt das Sorgenkind unserer Tage: der Dialog mit den Muslimen, die hier wohnen. Klar, mit denjenigen Fundamentalisten, auch den jüdischen, die z.B. Jizchak Rabin auf dem Gewissen haben oder Jesiden, Christen ja andere Auslegungen des Islam innerhalb ihrer eigenen Reihen mit körperlichen Attacken, mit Mord oder Totschlag, beantworten, kann man nicht sprechen! Vor ihnen kann man nur fliehen und sich oder andere in Sicherheit bringen.
Alle anderen sind Mitmenschen, Nachbarn oder Gesprächspartner: Man kann und soll miteinander reden, lustvoll streiten und gegenseitig voneinander lernen. Das ist sicherlich die schwierigste Herausforderung vor der jüdisches Leben heute steht, aber unsere christlichen Nachbargemeinden teilen mit uns das Problem. Dass jüdisches Leben in Berlin heute ein ganz selbstverständlicher Teil deutscher Wirklichkeit ist, haben wir gemeinsam geschaffen –und auch die Zukunft einer toleranten Gesellschaft in Deutschland können wir nur gemeinsam erreichen. So wie der Prophet Zacharias es sagt: "'Nicht durch Macht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist', spricht der Herr der Heerscharen." (Zach 4,6)
Andreas Nachama ist Rabbiner der Synagoge Sukkat Schalom in der Charlottenburger Herbartstraße, Professor am Touro College Berlin und leitet die Topographie des Terrors.
20.Januar 2015
„Erinnern und Gedenken“.
Ökumenischer Gottesdienst zum Jahrestag der Wannseekonferenz
Andreaskirche, Berlin Wannsee, Lindenstr.3

von rechts anach links:Pfarrer Lutz Nehk, Beauftragter für Erinnerungskultur und
Gedenkstättenarbeit des Erzbistums Berlin;
Pfarrerin Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur der
Evangelischen Kirche Berlin- Brandenburg-Schlesische
Oberlausitz;
Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama, Synagoge Sukkat Schalom;
Pfarrer Michael Raddatz, Evangelische Kirchengemeinde
Wannsee; Michael Jenne, GKR-Vorsitzender EKG Wannsee
08.01.2015

Holocaust-Gedenken in Berlin-Grunewald
Bauprojekt verhindert „Bürgergarten der Erinnerung“
Cay Dobberke
In einem „Bürgergarten“ wollten Anwohner der Grunewalder Wissmannstraße an ermordete und vertriebene jüdische Grundstücksbesitzer erinnern. Doch nun ließ ein Investor fast alle Bäume für eine Luxusvilla abholzen. Das Gedenkprojekt geht anders weiter. […] Unterstützer baten um Aufschub
Barbara Gstaltmayr sagt, ihr sei ein „Ultimatum“ bis Weihnachten gestellt worden. Ohne Kenntnis der geforderten Summe und in so kurzer Zeit sei es unmöglich gewesen, etwa einen Förderantrag bei der Lottostiftung zu stellen. Bereits im Sommer hatten prominente Unterstützer wie Andreas Nachama (Stiftung Topographie des Terrors), Hermann Simon (Centrum Judaicum) und Julius Schoeps (Moses Mendelssohn Zentrum, Potsdam) um ein „Moratorium“ bei der Bauplanung gebeten.
Die Immobilienfirma bietet nach eigenen Angaben ein „würdiges Gedenken“ an Familie Barasch an, denkbar sei eine Tafel in einer Ecke des Gartens. Laut Barbara Gstaltmayr halten Barasch' Nachfahren in den USA davon nichts.
|
Archiv
nach
oben
|
|
|




 es/msh (KNA, epd)
es/msh (KNA, epd) 


 (Foto: privat)
(Foto: privat)
 Salzkörner,
Sonderausgabe 2015
Salzkörner,
Sonderausgabe 2015 
