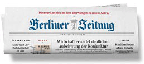Berliner Zeitung, 24. April 2003 Wer geht denn schon nach Israel?
[...] Wie konnte Berlin wieder Heimatstadt für Juden werden, die die Shoah überlebt haben? Diese Frage haben die Historiker Ulrich Eckhardt und Andreas Nachama nicht nur Eva Kemlein, sondern weiteren 13 Berliner Juden gestellt und darauf ganz unterschiedliche Antworten erhalten. "Es stimmt alles und es stimmt auch nicht", sagt Nachama. Diese Ausstellung und das dazugehörige Buch sind keine dokumentierte Geschichte. Vielmehr haben die beiden Historiker Biografien in der Ich-Form zusammengestellt und die Befragten einfach erzählen lassen. Eckhardt und Nachama wollen zeigen, dass jüdisches Leben im Nachkriegsdeutschland vielfältige Erinnerungen wecken kann.
[...]
Heinrich Simon, Lilli Nachama und der langjährige Vorsitzende der Ostberliner Jüdischen Gemeinde, Peter Kirchner, unterscheiden sich deutlich von der Sozialistin Ingeborg Hunzinger, die, wie sie betont, wenig mit der jüdischen Religion gemein hat. Zu den Befragten gehören auch Ruth Galinski, Witwe des 1992 verstorbenen Zentralratsvorsitzenden Heinz Galinski, der Berliner Ehrenprofessor Ernst Cramer und der langjährige Gemeindevorsitzende Jerzy Kanal, Überlebender des Warschauer Ghettos. "Ein Versuch, die Facetten jüdischen Lebens darzustellen", so Nachama. Die Gespräche schwanken zwischen Resignation und Engagement, zwischen unendlicher Traurigkeit und Ankunft in einer veränderten Welt. "Wenn ich als Überlebender sehen muss, dass junge Nazis über den Kudamm marschieren dürfen, dass das hingenommen wird in diesem Land", beklagt nicht nur der Berliner Manfred Alpern.
Gudrun Wilhelmy
Hagalil Online, im April 2003 [...] Die Ausstellung ist beachtenswert konzipiert. Die Farben des Buchumschlages sind dabei aufgegriffen worden und selbstverständlich die einfühlsamen Portraitfotografien von Elke Nord. Im Eingangsbereich sind auf Pulten zusätzlich drei kleinere Fotografien der Interviewten zu sehen, daneben ein charakterisierendes Zitat und - sehr schön - das gesamte Interview als Abdruck zum Lesen ausgelegt.
Auf diese Weise können Besucher die Persönlichkeiten recht schnell erfassen. Die Interviews verleiten zum Lesen und wer nur schnell einen Einblick gewinnen will, findet sich fast ungewollt plötzlich mitten im Interviewtext - oder bereits an dessen Ende. Die Texte sind so redigiert und den Prämissen einer schriftlichen Veröffentlichung angepasst, doch genau dass, was den einzelnen Menschen besonders macht, spricht aus den Sätzen.
[...] Überraschend ist jedoch eine technische Raffinesse in der Ausstellung. Mit Hilfe einer Software ist in den einzelnen Ausstellungskojen immer wieder ein Teil des Original-Interviews eines der Portraitierten zu hören. Oder ist es zu sehen, weil es möglich ist, der sprechenden Person zugleich ins Gesicht zu sehen? Um einer Übertönung vorzubeugen, sind nicht immer in allen Kojen gleichzeitig Stimmen zu hören. Denn dass, was zu hören ist - oder zu lesen - verwickelt diejenigen miteinander ins Gespräch, die dort stehen und zuhören. ...........mehr
Jüdisches Berlin 06/2003 Begehe ich Verrrat?
Esther Slevogt
[...] In der Textanthologie, deren Beiträge auf der Basis von Tonband-Interviews entstanden sind, kann man noch einmal einige Schicksale und Geschichten jener Generation nachlesen, ohne die es ein jüdisches Leben in Deutschland heute nicht geben würde. Der Stichtag, von dem die biografischen Erzählungen meist ihren Ausgang nehmen, ist der 8. Mai 1945, der Tag der deutschen Kapitulation, den die einzelnen als Tag der Befreiung ganz unterschiedlich erlebten: auf den Straßen von Tel Aviv, irgendwo im Exil, als amerikanischer Soldat, als "Illegale" im Untergrund, als Emigranten, Flüchtlinge oder KZ-Insassen. Der 8. Mai ist auch Spiegelachse zu r Vorkriegsgeschichte der Familien, deren Entrechtung und Ermordung. Oft sind die Erzähler die einzigen Überlebenden ihrer Familien. [...]Juli August 2003
14 jüdische Berliner
Von Rosa Lewin
Wenn man mit älteren Berliner Juden über ihr Leben nach der Schoa spricht, darin schließt das zwangsläufig zwei Fragen ein: Wie hast du überlebt? und Warum bist du hier geblieben? So ist das auch in den Interviews für die Ausstellung "Leben nach der Schoa« im Centrum Judaicurn, die eine Gruppe von Mitgliedern des JKV kürzlich besucht hat. 14 Berliner Juden, von Ruth Galinski bis Ingeborg Hunzinger, von Jerzy Kanal bis Peter Kirchner, von Eva Keimlein bis Lilli Nachama gaben ihre Schicksale zu Protokoll, was man in der Ausstellung nachlesen kann. Ihre Antworten auf die Frage nach den Motiven der Entscheidung für Berlin fielen höchst unterschiedlich aus. Eva Kemlein, bekannte und erfolgreiche Theaterfotografin, nennt Politische Gründe, die interessante Arbeit an den Berliner Bühnen und schließlich die vielen Freunde [...]. Sie sagt: "Es gab für mich nie die Versuchung, das Land zu verlassen.« Jerzy Kanal, langjähriger Stellvertreter und über fünf Jahre Nachfolger Heinz Galinskis, erklärt, es habe sich so ergeben, und es bereite ihm noch immer mentale Probleme an diesem Ort zu sein. Ernst Cramer hingegen, der Vorstandsvorsitzende der Axel-Springer-Stiftung, kehrte als amerikanischer Soldat nach Deutschland zurück und entschloss sich zu bleiben. »Meine Entscheidung für Deutschland bleibt richtig«, konstatiert er. "Es ist gut für Land und Demokratie, dass Juden wieder hier leben und arbeiten.« Die Bildhauerin Ingeborg Hunzinger glaubte an die kommunistische Perspektive der DDR als ein anderes, erneuertes Deutschland, als aritifaschistischer Staat. [...] Der Arzt Peter Kirchner bilanziert sein 20-jähriges Wirken als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Ostberlins und sagt, er sei in seinem Leben in der DDR kein unglücklicher Mensch geworden. Die Entscheidung zum Bleiben in Ostberlin sei insgesamt nicht falsch gewesen. »Wenn ich heute in die Oranienburger Straße komme und den Glanz der Kuppel sehe, habe ich das Gefühl, dass sich unsere Hartnäckigkeit gelohnt hat. Lilli Nachama verwitwete Ehefrau von Oberkantor Estrongo Nachama räumt fünf Jahrzehnte nach der Befreiung ein: »Als in den letzten Jahren die NPD so hoch kam muss ich ehrlich sagen: Wenn man das vorher gewusst hätte, wäre man bestimmt nicht hier geblieben. Denn man hat doch geglaubt, mit 1945 ist endlich endlich Ruhe und die braune Pest ist weg[...].
Jüdische Allgemeine 14. August 2003
Leben nach der Schoa
[...] ein Sammelband mit Tonband Interviews [...], den Andreas Nachama und Ulrich Eckhardt herausgegeben haben. Sie sprachen mit Menschen, die nach 1945 nach Berlin zurückgekommen waren - trotz allem - oder, die der Zufall hierher verschlug [...].Es sind ergreifende, traurige, abenteuerliche Geschichten, die von erlittenem Leid, Mut, Kraft und Lebenswillen künden [...]