Tagebuch
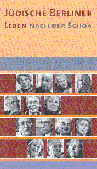
Jüdische
Berliner
LEBEN nach der Schoa
14 Gespräche aufgezeichnet
von Ulrich Eckhardt und Andreas Nachama
Photographie Elke Nord
Gespräche mit und Photographien von
Manfred Alpern|Inge Borck|Ernst Cramer|Ruth Galinski
Ingeborg Hunzinger|Jerzy Kanal|Eva Kemlein|Peter Kirchner
Lilli Nachama|Ilse Rewald|Heinrich Simon|Susanne Thaler
Horst Tichauer|Herta Wolff
AUSSTELLUNG
im Centrum Judaicum
Centrum Judaicum| Oranienburger Str. 28/30|10117
Berlin
So-Do 10-18 Uhr|Fr. 10-14 Uhr
Zur Ausstellung erscheint ein
Begleitbuch
mit den Aufzeichnungen der 14 Gespräche mehr
zur Ausstellung/Presseberichte
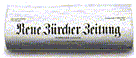
Neue Züricher
Zeitung 22. April 2003
Vierzehn Jüdinnen und
Juden porträtiert die Schau mit dem Titel «Jüdische Berliner
Leben nach der Schoa», über dessen bewusst doppeldeutige Schreibweise
man leicht stolpert. Sie zeigt Menschen, welche die Judenverfolgung im
Dritten Reich überlebten und danach weiter in Berlin blieben oder
sich hier ansiedelten. Ihre Aussagen muten oft an wie diejenigen eines
Fremden im eigenen Land, zwischen «Integrationswunsch und Separationsinstinkt»
schwankend, wie es Andreas Nachama und Ulrich Eckhardt in ihrem Vorwort
zum Begleitbuch nennen.
In Interviews, auf Tonband oder in transkribierter Form, illustriert von
Elke Nords Photographien, werden die Lebensgeschichten nachgezeichnet.
Durch die schlicht gehaltene Ausstellung dringen Stimmen von Tonbändern
aus den einzelnen Nischen. Die allmählich sterbende Generation der
Überlebenden richtet sich hier «zu später Stunde»
(Nachama) an die Nachkommenden. Alle beschäftigt die Frage, wie es
möglich war, dass Juden nach Deutschland zurückkehrten und hier
weiterlebten - entgegen Leo Baecks Prophezeiung, wonach die Epoche der
Juden in Deutschland nach dem Holocaust ein für alle Mal vorbei gewesen
sei. Wer nach Kriegsende blieb oder zurückkehrte, handelte oft genug
so, weil Hitlers Ziel eines judenfreien Deutschland nicht nachträglich
Realität werden sollte. Es hält sich der Zweifel, ob das Bleiben
richtig war, und darüber hinaus die Frage, ob man selbst damit überhaupt
etwas bewirken konnte.
Alle Lebensgeschichten zeugen vom ungebrochenen Willen, im Leben und in
der deutschen Heimat wieder Fuss zu fassen. Dabei täuscht der fast
nebenbei geäusserte Wunsch, «zu sein wie die anderen»,
nicht darüber hinweg, welchen Kraftaufwand die angestrebte Normalität
zu jeder Zeit bedeutet - in der Nachkriegsgesellschaft inmitten der Täter
und heute wieder in Anbetracht der in aller Offenheit demonstrierenden
NPD-Anhänger. Die Ausstellung macht ohne didaktischen Unterton unmissverständlich
deutlich, dass das Leben der Juden in Deutschland ein Prüfstein für
die deutsche Demokratie bleibt.
Claudia Schwartz
.................mehr
 |
|
| 1. April 2003 Jüdisches Berlin 4 /2003 |
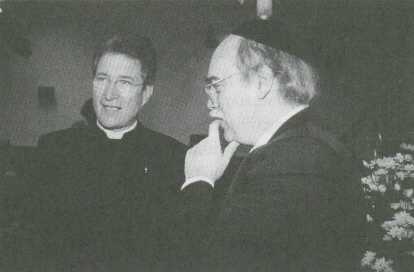
Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit
In Gegenwart vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit,
Bischof Wolfgang Huber und Georg Kardinal Sterzinsky
hielt Rabbiner Andreas Nachama
Unter dem Motto "Uns ist gesagt, was gut ist" Micha 6,8 die
Festrede.
Die Manuskriptvorlage ist in ![]() ,
,
Zentralrogan Demokratischer Widerstandskämpfer und Verfolgten-Organisationen,
50. Jahrgang, Nr. 4 vom 1. April 2003 abgedruckt.
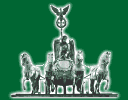 |
|
| 10. März 2003 Berliner Morgenpost |
Den Festvortrag hielt der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, Rabbiner Andreas Nachama. Dieser nahm das Motto der Woche der Brüderlichkeit aus dem Micha-Buch der Bibel - "Uns ist gesagt, was gut ist" - auf und mahnte die Kirchen und die Berliner, sich nicht vom Reichtum, Luxus und der Gier nach Besitz leiten zu lassen. Gleichzeitig sprach Nachama davon, dass der gesamte "Staatsapparat in Bewegung gehalten werden muss, um die unveräußerlichen Menschenrechte gegen Gewalt und Unrecht zu schützen".
| 27. März 2003 |
Eröffnung des Theodorus Hospiz
Segen für das Hospiz
Supterintendent Lothar Wittkopf
Domprobst Otto Riedel
Dipl. Theologe Erol Dagalasi
Rabbiner Dr. Andreas Nachama
GEBET
für das Hospiz
Zur Umbenennung der Treitschkestraße
 |
|
| 13. März 2003 Jüdische Allgemeine |
Auch Andreas Nachama, Mitglied der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde und Leiter der Gedenkstätte Topographie des Terrors, bewertet den Vorstoß der Steglitzer SPD zurückhaltend. "Natürlich sollte man jede Chance nutzen, diesen unsäglichen Straßennamen loszuwerden. Die Stadt muß in der Lage sein, ihr Gedächtnis zu aktualisieren. Ob aber diese Entscheidung bei einem Senat, der noch immer an der Ehrenbürgerwürde für Hindenburg festhält, in den richtigen Händen ist, bezweifele ich."
Zum Streit um die Predigerliste
| Die Tageszeitung 11. April 2003 |
Nachama bleibt doch Rabbiner
Der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Berlin, Andreas
Nachama, ist von der Synagoge Hüttenweg in Zehlendorf als Rabbiner
verpflichtet worden. Damit solle sichergestellt werden, dass Nachama auch
weiter in der Synagoge Gottesdienste leiten könne, erklärte
gestern der Vorsitzende des Vereins Sukkat Schalom, Dan Moses.
......mehr
Weitere Presseausrisse zum Streit um die "Predigerliste" der Jüdischen Gemeinde
Reisetagebuch
13. Februar 2003
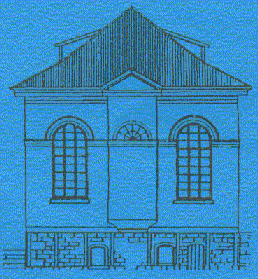 |
Begegnungsstätte
Kleine Synagoge Erfurt Vortrag Einführung in den Synagogengottesdienst |
|
4. März 2003 |
Bürgersaal der Stadt Seesen |
 |
vormals Almunat der Jacobsohn-Schule Vortrag Das liberale Judentum in Deutschland im 19. Jahrhundert |
 |
Ausriß aus dem Mitteilungsblatt des American Jewish Committee in Miami, Mai 2003 |