Tagebuch
![]() 19.
06. 2001
19.
06. 2001
Wann feiert ein jüdischer Astronaut den Sabbat?
Nachama über das Moderne im Rabbinatsamt
Von Gernot Wolfram
Berlin - Nehmen wir den seltsamen Fall an, der bisher noch nicht eingetreten
ist: ein jüdischer Astronaut startet in den Weltraum, oder, prekärer
noch, zwei jüdische Astronauten aus unterschiedlichen Ländern
gehen auf Raumfahrt - welche Ortszeit ist dann die für den Sabbat
verbindliche? Die des jeweiligen Landes, aus dem die Astronauten kommen,
oder gibt die Herkunft des älteren die gültige Stunde vor?
Das sind in ihrer Kuriosität dennoch komplexe Fragen für einen
Rabbiner, zu dessen Aufgaben es gehört, "Antworten für
Probleme zu finden, ehe sie überhaupt aufkommen". So jedenfalls
definiert Andreas Nachama, selbst Rabbiner und vor kurzem noch Vorsitzender
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, das Amt des jüdischen Gelehrten,
das bis auf die Zeit des Tempels in Jerusalem zurückgeht. Bei den
Astronauten hat man sich schließlich religiös erleichtert darauf
geeinigt, dass die Ortszeit der Station, wo die Rakete abhebt, für
den Sabbat die verbindliche Orientierung ist. Bei anderen illustren Streitfällen
brüten bis heute die jüdischen Schriftkenner über Lösungen.
Andreas Nachama, der bereits während seiner Amtszeit als Gemeindevorsitzender
den Vortrag über "Wunschvorstellungen und Realität in der
Rolle des Rabbiners" zugesagt hatte, sprach in der Katholischen Akademie
mit Kennerschaft und Enthusiasmus über die verschiedenen Möglichkeiten
eines Rabbiners, sich als Ratgeber, Lehrer, Sozialarbeiter und Seelsorger,
aber auch als politischer Aktivist am Leben seiner Gemeinde zu beteiligen.
Als Unterstrom seines Vortrags, der mit Ruhe und Sorgfalt frei vorgetragen
wurde, hörte man bei Nachama (angetan mit schwarzer Kippa und dunklem
Anzug) eine gewisse Wehmut und Enttäuschung heraus, die aus dem Wahldebakel
herzurühren scheint, in der die Wahlkampfgruppe Nachamas ("Jüdische
Einheit") zwischen die Räder von Polemik und unsachlichen Diskussionen
geriet.
Nachama, der für ein offenes Judentum steht, in dem nicht die Shoa
den Kernmoment neuer jüdischer Identität bildet, sondern das
kulturelle und religiöse Selbstbewusstsein, scheint jedenfalls erleichtert
zu sein, in Zukunft nicht mehr in marginale Diskussionen verwickelt zu
werden. "Ich bin niemand, der gerne polarisiert", sagt er. In
Anbetracht seiner profunden historischen Kenntnisse wird deutlich, dass
der Wissenschaftler und Politiker in ihm stets in einem schwierigen Spannungsverhältnis
standen. Den praktischen Ansprüchen einer der schwierigsten jüdischen
Gemeinden in Deutschland gerecht zu werden und zugleich ein visionäres
Konzept im Auge zu behalten, das nicht mehr und nicht weniger will als
eine Neubesinnung auf die Wurzeln der jüdischen Kultur, lässt
sich vielleicht erst im Nachhinein als fast unmöglicher Spagat erkennen.
Dass Nachama gerade den wissenschaftlichen, forschenden und somit politischen
Aspekt in der Rolle des Rabbiners betont, der im Unterschied zu den orthodoxen
Rabbinern, die ganz aus der Tradition schöpfen, einen modernen Gesellschaftsanspruch
enthält, ist für den christlich-jüdischen Dialog von großer
Bedeutung.
Die moralische Sonntagsrede, wie sie die Kirchen hier zu Lande praktizieren,
erreicht die Menschen kaum noch. Der religiöse Gelehrte muss immer
auch ein zweifelnder Mitdenker der Gesellschaft sein, in der er lebt.
Insofern sind das kuriose Sabbat-Mahl im Weltraum und die weniger kuriose
Frage nach einer undogmatischen religiösen Ethik in der modernen
Welt nicht nur Problemstellungen für Rabbiner, sondern für alle
diejenigen, die, wie Nachama sagt, "keine moralischen Richter, sondern
Ratgeber suchen".
|
|
| 14. Oktober 2001 Der Tagesspiegel |
Wo ist Gott?
....So ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich finden lassen,
sagt der Ewige. Was für eine Suche ist gemeint?
... mehr
 |
Aus der Rede anläßlich der Enthüllung eines Bauschildes für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin: |
| 10.Oktober 2001 |
Lange Zeit in meiner Kinder- und Jugendzeit
habe ich nicht verstanden, warum dieser Mann oder jene Frau zu denen gehörte,
von denen mein Vater sagte, auch ein Auschwitz Überlebender, oder
meine Mutter, auch ein U-Boot, ein Illegaler oder eine Illegale, aber
kein Kommunist, kein Sozialdemokrat, kein Zeuge Jehova, kein Sinto oder
Roma und auch kein Jude. Was dann?
Die Juden werden meist, wohl weil sie die zahlenmäßig größte
Opfergruppe der NS-Herrschaft waren, als d i e Opfergruppe angesehen,
ja es bürgerte sich ein, nur noch von der Schoa und dem Holocaust
zu sprechen und die anderen Opfergruppen auszublenden. Damit geht man
nur den Nationalsozialisten auf den Leim, die die anderen Opfergruppen,
weil sie doch potentiell Volksgenossen hätten sein können, ausblendeten.
Das mag die anderen Opfergruppen zu Recht schmerzen, aber eine besondere
Ehre für die so freigestellten Juden ist es auch nicht, denn es vernebelt,
dass ihre Verfolgung wie die anderer Gruppen reine Willkür der Nationalsozialisten
war, die eben das Grundmotiv der französischen Revolution, das da
lautet, vor dem Gesetz sind alle gleich, vernachlässigte. Heute wissen
auch die Juden in aller Welt, sie haben in einer Gesellschaft nicht mehr
Rechte, als die jeweils schwächste Minorität. Wir freuen uns
für unsere geschundenen Schwestern und Brüder, dass unsere Gesellschaft
ihren Nachfahren gleiche Rechte einräumt, ja es ist ein gesellschaftlicher
Umbruch, dass eine Person, die sich zu ihrer Homosexualität öffentlich
bekennt, heute Regierender Bürgermeister ist. Wäre das vor sieben
Jahrzehnten möglich gewesen, bedürfte es unserer heutigen Zusammenkunft
nicht.
............mehr
| 27.November 2001 die tageszeitung |
Philipp
Gessler: Andreas Nachama? Die Macht
des Wortes
Als er noch Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde war, beklagte
Andreas Nachama gern, dass er von vielen nur noch in seiner Funktion wahrgenommen
werde: nicht mehr als der Bürger und Berliner Nachama. Nun ist Nachama,
der heute 50 Jahre alt wird, schon etwa ein halbes Jahr nicht mehr Gemeindechef.
Seit dem 1. September arbeitet er wieder als Geschäftsführer
der "Topographie des Terrors" - ein Posten, von dem er nur beurlaubt
war. In dieser neuen, alten Position ist er nicht mehr so häufig
öffentlich präsent - doch vernehmbar gleichwohl: als engagierter
Bürger, Citoyen, der seine Stimme für die Res publica erhebt.
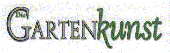 |
|
| Die Gartenkunst 1/2003 (15. Jahrgang) |
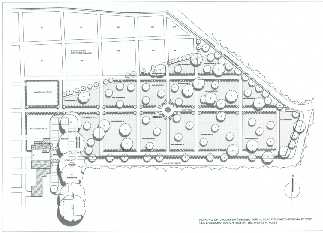 |
Entwurfsplan Friedhofserweiterung
2000 Planung Dr. Jacobs und Hübinger, Berlin | Büro für Gartendenkmalspflege und Landschaftsarchitektur |
Die Erweiterung des Jüdischen Friedhofs am Scholzplatz in Berlin
Joachim G. Jacobs
"[...] Trotz der Bemühungen seiner Vorgänger gelang es erst dem Gemeindevorsitzenden Rabbiner Dr. Andreas Nachama nach zähen Verhandlungen mit dem Senat von Berlin, eine weitere, 1 ha große Erweitungsfläche [vom Land Berlin] erwerben zu können. [...] Am 15. Dezember 2000 wurde die Erweiterungsfläche durch den Gemeindevorsitzenden Dr. Andreas Nachama in Anwesenheit de Gemeinderabbiner, des Senators für Stadtentwicklung, Peter Strieder und vieler Gemeindemitglieder übergeben."[...]